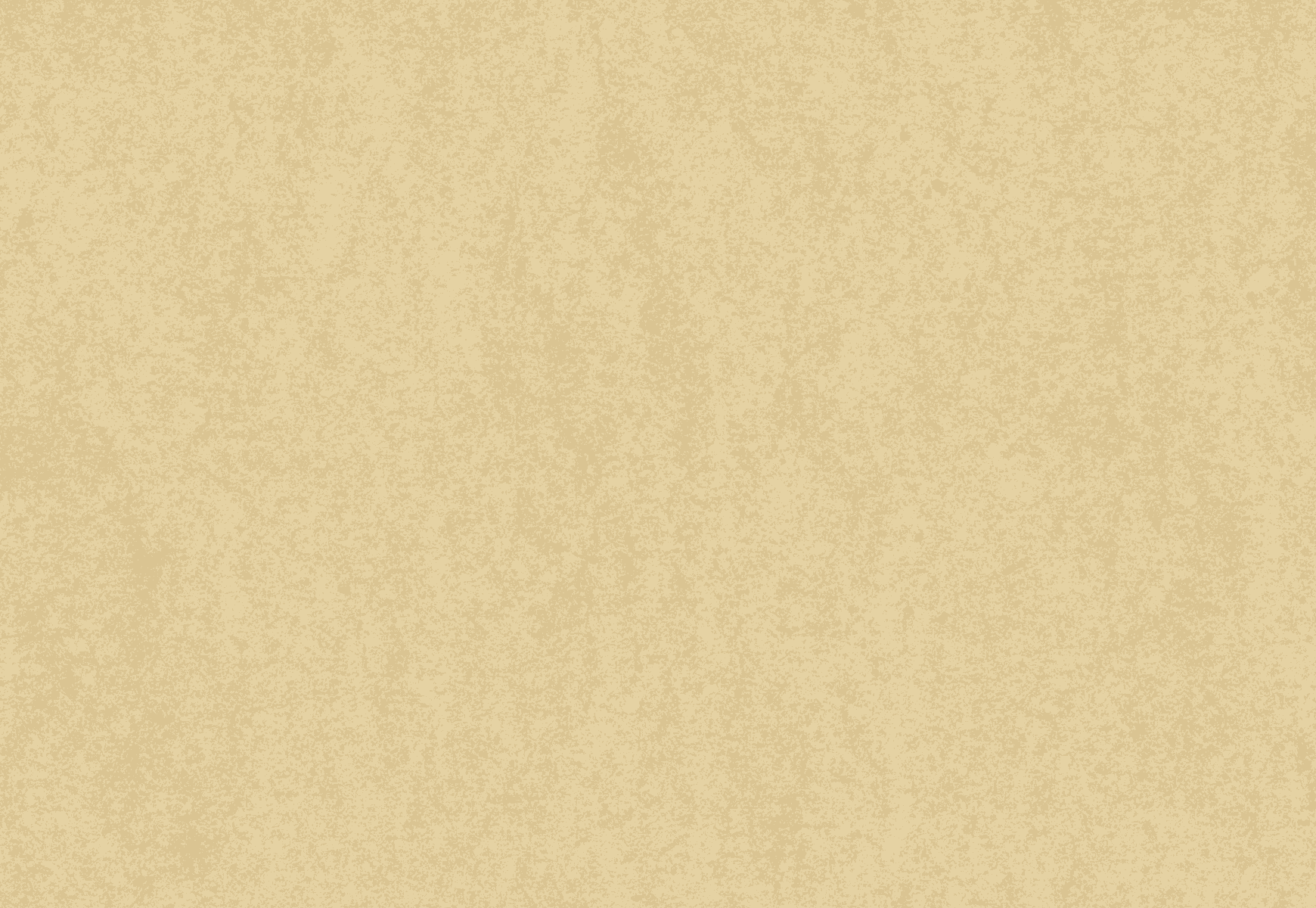Sega Game Gear


Der Sega Game Gear (jap. .mw-parser-output .Kana{font-size:120%}ゲームギア, Gēmu gia) ist eine Handheld-Konsole von Sega, die erstmals am 6. Oktober 1990 in Japan veröffentlicht wurde. Als Konsole der vierten Generation stand er in direkter Konkurrenz zu Ataris Atari Lynx und Nintendos Game Boy.
Beschreibung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Arbeit an der Konsole begann nach dem Erscheinen des Game Boys im Jahr 1989. Zu diesem Zeitpunkt lief die Entwicklung des Gerätes unter dem Codenamen Project Mercury. Das Ziel war es, ein dem Nintendo Game Boy überlegenes Produkt am Markt anbieten zu können.
Das System erschien am 6. Oktober 1990 in Japan, im Jahr 1991 in Nordamerika und in Europa und erst im Jahr 1992 schließlich in Australien. Der unverbindliche Verkaufspreis lag zum Zeitpunkt der Markteinführung bei 299 DM. Ähnlich wie bei Nintendos Game Boy, der mit dem Spiel Tetris verkauft wurde, wurde der Game Gear im Bundle mit dem Spiel Columns verkauft.
Der Game Gear war im Prinzip ein tragbares Sega Master System, allerdings mit einer größeren Farbpalette und geringeren Auflösung. Dank Farbdisplay und Hintergrundbeleuchtung war er dem Game Boy grafisch überlegen, außerdem war die Soundausgabe besser. Der Prozessor war allerdings etwas langsamer getaktet (Game Boy 4,2 MHz, Game Gear 3,58 MHz).[1] Zusätzlich gab es einen als Zubehör erhältlichen ansteckbaren TV-Tuner, der den Empfang des analogen Fernsehprogramms erlaubte.
Trotz seiner technischen Überlegenheit konnte der Game Gear keinen bedeutenden Marktanteil erzielen, was an der enormen Popularität des Game Boy und einer Reihe von Nachteilen gegenüber jenem lag:
- Der beleuchtete Bildschirm hatte zur Folge, dass die Batterielaufzeit mit sechs Mignon-Batterien ca. fünf Stunden betrug (bei der späteren optimierten Version vier Stunden). Mit einem als Zubehör erhältlichen SEGA-Akku-Pack waren es etwa vier Stunden mehr. Im Vergleich zu den durchschnittlich 14 Stunden des Game Boys mit vier Batterien ist die Laufzeit wesentlich geringer
- Die Form des Game Gears war vergleichsweise groß, sodass er sich dadurch nicht so leicht wie ein Game Boy in eine Jackentasche o. Ä. stecken ließ
- Der Game Gear war mit einem Preis von etwa 300 DM doppelt so teuer wie der Game Boy
- Die vergleichende Werbung in den USA, welche den weit verbreiteten und beliebten Game Boy als technisch simpel und seine Benutzer als einfältig diffamierte, verprellte sehr viele potenzielle Kunden
- Hauptsächlich litt der Game Gear jedoch unter einem Mangel an Spielen. Da die Entwicklung erst nach der Veröffentlichung des Game Boy begann, hatten sich bereits viele Spieleentwickler auf diesen spezialisiert. Durch den fehlenden kommerziellen Erfolg des SEGA-Handheld bestand auch kein Anreiz, für beide Systeme zu entwickeln
Aufgrund der technischen Ähnlichkeiten zwischen Master System und Game Gear wurden viele Master-System-Spiele portiert. Ein Konverter, der Master Gear, erlaubte es, Master-System-Spiele auf dem Game Gear zu spielen. Umgekehrt war dies nicht möglich, da der Game Gear über eine größere Farbpalette verfügte. Später profitierte der Game Gear von der Popularität des Sega Mega Drive und erhielt Portierungen von Mega-Drive-Spielen wie Ristar und den ersten zwei Teilen von Streets of Rage.
Zurückblickend gesehen wird der Game Gear weitestgehend als Fehlschlag betrachtet, warf für SEGA jedoch einen bescheidenen Gewinn ab. Trotzdem versuchte sich SEGA 1995 wieder auf dem Konsolenmarkt mit dem Sega Nomad, einem tragbaren Sega Mega Drive, welcher nie in Europa erhältlich war. Trotz allem schlug sich der Game Gear besser als andere Systeme, die versuchten, mit dem Game Boy zu konkurrieren. Die Game-Gear-Unterstützung wurde 1997[1] endgültig eingestellt; Majesco veröffentlichte 2001 jedoch eine spezielle Version des Game Gears (genannt Core) zum reduzierten Preis neben der Wiederveröffentlichung einiger Spiele.
Durch die zunehmende Verbreitung von DVB-T und der einhergehenden Analogabschaltung des terrestrischen Fernsehens in weiten Teilen Europas ist der Fernsehempfang mit dem optionalen TV-Tuner mittlerweile sowohl in Deutschland als auch in Österreich und der Schweiz nur noch mit einem Antennenadapter in Kabelnetzen möglich.
Ein weiteres Problem sind die verwendeten Kondensatoren, die mit der Zeit an Kapazität verlieren. Dies äußert sich durch einen sehr leisen Ton und einen sehr geringen Kontrast und einer geringen Helligkeit des Bildschirms.
Technische Daten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Hauptprozessor: Zilog Z80 (8-bit)
- Prozessortakt: 3,58 MHz
- Auflösung: 160 × 144 Pixel
- Darstellbare Farben: 4096
- Gleichzeitig darstellbare Farben: 32 (Fernsehtuner: alle 4096 gleichzeitig)
- Maximale Anzahl an Sprites: 64
- Sprite-Größe: 8 × 8 oder 8 × 16 (oder das Doppelte im Zoom-Modus)
- Bildschirmdiagonale: 8,1 cm (3,2 in)
- Hintergrundbeleuchtung: CCFL
- Größe: 20 cm × 11 cm × 3,4 cm
- Gewicht: etwa 400 g
- Stromversorgung: 6 AA-Batterien, Battery Pack oder 9-V-Netzstecker
- Audio: Vierkanalton
- RAM: 8 KB
- Video-RAM: 16 KB
- Zubehör: Fernsehtuner, FM-Tuner, Uhr, Battery Packs, Master Gear Converter, Screen Lens (Lupe für ein größeres Bild), Carry Case (Tasche für Game Gear, Battery Pack und einige Spiele), Gear2Gear-Linkkabel
Spiele (Auswahl)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Es erschienen mehr als 300 Spiele für die Konsole. Eine Vielzahl davon waren Portierungen von anderen Sega-Konsolen wie dem Master System und Mega Drive.
Nachfolgend eine Liste ausgewählter Spiele:
- Castle of Illusion – Starring Micky Mouse
- Columns
- Micro Machines
- NBA Jam
- Power Strike II
- Road Rash
- The GG Shinobi II
- Sonic the Hedgehog
- Sonic the Hedgehog 2
- Sonic the Hedgehog Chaos
- Sonic the Hedgehog Triple Trouble
- Sonic Blast
- Streets of Rage
- Wonder Boy
Game Gear Micro
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Am 3. Juni 2020, dem 60. Jahr des Bestehens der Firma, stellte Sega den Game Gear Micro (ゲームギアミクロ) vor, der in vier verschiedenen Farben (grau, blau, gelb und rot) ab dem 6. Oktober 2020 ausschließlich in Japan zu einem Preis von 4.980 Yen, umgerechnet etwa 40 €, erhältlich war. Jede Variante hat vier unterschiedliche Spiele vorinstalliert:
- Grau: Sonic The Hedgehog, Out Run, Royal Stone und Puyo Puyo Tsu
- Blau: Sonic the Hedgehog Chaos, Gunstar Heroes, Sylvan Tale und Baku Baku Animal
- Rot: Shinobi, Columns und die beiden Megami-Tensei-Gaiden-Spiele
- Gelb: Shining Force Gaiden, Shining Force Gaiden 2, Shining Force Gaiden: Final Conflict und Nazo Puyo Aruru no Ru
Für umgerechnet etwa 200 € erschien daneben ein Extra-Bundle geben, das alle vier Farbversionen sowie ein Vergrößerungsaccessoire namens „Big Window Micro“ enthält. Die Bildschirmdiagonale beträgt 1,15 Zoll (2,9 cm).[4][5]
Zusätzlich erschien eine weiße Farbvariante, die nur im Bundle mit der limitierten Edition der Aleste Collection angeboten wurde. Diese limitierte Auflage enthält neben einem Game Gear Micro in Weiß, auch ein „Big Window Micro“ in Weiß. Es sind die Spiele der Aleste-Reihe vorinstalliert: „Aleste“, „GG Aleste“, „GG Aleste II“, „GG Aleste III“, sowie „Power Strike 2“.
GG Aleste III ist eine neue Entwicklung für den Game Gear und erschien im Rahmen dieser Kollektion.
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- neXGam.de – Spieletests und Hardware-Spezifikationen
- Offizielle Website des Game Gear Micro (japanisch)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ a b c SEGA Hardware Geschichte. In: sega-network.de. 2003, abgerufen am 10. Februar 2020.
- ↑ a b .mw-parser-output .webarchiv-memento a{color:inherit}Feature: The 10 Worst-Selling Handhelds of All Time (Memento vom 30. Juli 2008 im Internet Archive), Gamepro.com, 30. Juli 2007.
- ↑ The top-selling GameGear games. In: vgchartz.com. Abgerufen am 8. Dezember 2019.
- ↑ Winzling zum Jubiläum: Sega kündigt "Game Gear Micro" an | Blick - Games. In: Blick. Archiviert vom .mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a{background-position:center right!important;background-repeat:no-repeat!important}body.skin-minerva .mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a{background-image:url("https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/OOjs_UI_icon_external-link-ltr-progressive.svg")!important;background-size:10px!important;padding-right:13px!important}body.skin-timeless .mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a,body.skin-monobook .mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a{background-image:url("https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/MediaWiki_external_link_icon.svg")!important;padding-right:13px!important}body.skin-vector .mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a{background-image:url("https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Link-external-small-ltr-progressive.svg")!important;background-size:0.857em!important;padding-right:1em!important}Original (nicht mehr online verfügbar) am 4. Juni 2020; abgerufen am 4. Juni 2020.
- ↑ Claus Ludewig: Sega feiert 60 Jahre mit neuem Game Gear Micro. In: PC Games. 3. Juni 2020, abgerufen am 4. Juni 2020.
Konsolensysteme: SG-1000 (1982) | Sega Master System (1986) | Sega Mega Drive (1989) | Sega Multi-Mega (1992/93) | Sega Mega-CD (1992/93) | Sega 32X (1994) | Sega Saturn (1994) | Dreamcast (1999) | Sega Mega Drive Mini (2019) | Sega Mega Drive Mini 2 (2022)
Handgeräte: Sega Game Gear (1990) | Sega Mega Jet (1994) | Sega Nomad (1995) | Sega Retro Gen (2009)
Sega Nomad
Der Sega Nomad (auch Genesis Nomad, Codename: „Venus“) ist eine Handheld-Konsolen-Variante des Sega Mega Drive (in Nordamerika als Sega Genesis bekannt) und erschien im Oktober 1995 ausschließlich in den USA. Aufgrund des mäßigen Erfolgs wurde auf eine Veröffentlichung in Europa und Japan verzichtet.
Mit dem Nomad können alle Genesis-Spiele gespielt werden, sowie alle Mega-Drive-Spiele, die keinen Regionalschutz besitzen. Ebenso kann das Gerät mit Mega-Drive-2-AV-Kabeln an einen Fernseher angeschlossen werden. Außerdem bietet der Nomad einen zweiten Controller-Port, so dass er auch als vollwertige Heimkonsole genutzt werden kann und war somit die seinerzeit kleinste existierende Heimkonsole. Die Stromversorgung erfolgt entweder über ein ansteckbares Batteriefach für sechs AA-Batterien, ein alternativ ansteckbares und wiederaufladbares Battery-Pack namens Power-Back (MK-6102), einen Stromadapter die 12-Volt-Kfz-Bordspannungssteckdose (MK-2115) oder das 230-Volt-Netzteil des Mega Drive 2.
Der Nomad kam zu einem Zeitpunkt auf den Markt, als bereits 32-Bit-Konsolen wie Sega Saturn und PlayStation veröffentlicht wurden. Zudem wurde der Nomad nicht als eigenständiger Handheld, sondern als tragbarer Mega Drive vermarktet. Diese Tatsachen und eine vergleichsweise geringe Batterielaufzeit von ca. zwei Stunden verwehrten dem Produkt einen größeren Erfolg.
Technische Daten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Hauptprozessor: Motorola 68000, 16-Bit, 7,67 MHz
- Koprozessor: Zilog Z80a, 8-Bit, 3,58 MHz
- Auflösung: 320×224 Pixel, 64 Farben
- Farbpalette: 512 Farben (RGB, 3 Bit pro Farbkanal)
- Spritegröße: (8, 16, 32) × (8, 16, 32)
- Bildschirm: Passiv-Farb-LC-Bildschirm, 320×224 Pixel
- Audio: 10 Kanäle (3 PSG-Square-Waves, 1 PSG-Noise, 6 FM, wobei der sechste Kanal durch einen PCM-Kanal ersetzt werden kann)
- RAM: 64 KB RAM (68000, Adressraum $FF0000 - $FFFFFF), 64 KB Video-RAM, 8 KB Z80-RAM (Oft auch Sound-RAM genannt)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ The 10 Worst-Selling Handhelds of All Time. In: Gamepro.com. Archiviert vom .mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a{background-position:center right!important;background-repeat:no-repeat!important}body.skin-minerva .mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a{background-image:url("https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/OOjs_UI_icon_external-link-ltr-progressive.svg")!important;background-size:10px!important;padding-right:13px!important}body.skin-timeless .mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a,body.skin-monobook .mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a{background-image:url("https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/MediaWiki_external_link_icon.svg")!important;padding-right:13px!important}body.skin-vector .mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a{background-image:url("https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Link-external-small-ltr-progressive.svg")!important;background-size:0.857em!important;padding-right:1em!important}Original (nicht mehr online verfügbar) am 7. Juni 2011; abgerufen am 4. September 2008 (englisch).
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Konsolensysteme: SG-1000 (1982) | Sega Master System (1986) | Sega Mega Drive (1989) | Sega Multi-Mega (1992/93) | Sega Mega-CD (1992/93) | Sega 32X (1994) | Sega Saturn (1994) | Dreamcast (1999) | Sega Mega Drive Mini (2019) | Sega Mega Drive Mini 2 (2022)
Handgeräte: Sega Game Gear (1990) | Sega Mega Jet (1994) | Sega Nomad (1995) | Sega Retro Gen (2009)
Sega Master System


Das Sega Master System (kurz SMS; jap. .mw-parser-output .Kana{font-size:120%}マスターシステム, Masutā Shisutemu) ist eine 8-Bit-Heimvideospielkonsole des japanischen Unternehmens Sega. Es stand in direkter Konkurrenz zum Famicom von Nintendo (in Amerika und Europa als NES vermarktet).
Geschichte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Als Nachfolger des SG-1000 Mark I und des SG-1000 Mark II wurde im Oktober 1985 das SG-1000 Mark III in Japan vorgestellt. Eine Verbesserung zu seinen Vorgängern stellten die größere Farbpalette, besseres Audio über die separat erhältliche FM-Unit und mehr interner Arbeitsspeicher dar. Im Juni 1986 wurde das System in neuem Design unter dem Namen Sega Master System auch in den USA veröffentlicht, ein Jahr nach dem USA-Start des Nintendo Entertainment Systems (NES). Anfänglich wurden die Spiele auf preisgünstigen Sega Cards ausgeliefert, welche aufgrund der Limitierung auf 256 KBit zugunsten von Cartridges (bis 8 MBit) aufgegeben wurden. Die Konsole kostete zum Verkaufsstart 200 US$. Anschließend wurde sie in anderen Märkten veröffentlicht, in Europa erschien sie 1987 unter ihrem neuen Namen.
Obwohl das Master System dem NES in manchen Bereichen technisch überlegen war, konnte es sich dennoch nicht gegen dieses durchsetzen. Der mäßige Erfolg des Systems wird verschiedenen Ursachen zugeschrieben, hauptsächlich der im Vergleich zum NES geringeren Anzahl erhältlicher Titel. Nintendos gute Beziehungen zu Drittentwicklern dürften ebenfalls nicht unerheblich gewesen sein; das Übereinkommen lief darauf hinaus, dass die Entwickler letztendlich nur Spiele für das NES entwickelten.
Japan
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Das SMS war in Japan nicht übermäßig erfolgreich, da das Nintendo Famicom, das mit dem japanischen Master System konkurrierte, den japanischen Markt beherrschte. Sowohl Mark III als auch das japanische Master System bieten Unterstützung für SG-1000-Spiele. Ebenso ist der FM-Chip in dem Gerät integriert, welcher beim Vorgänger als Add-on FM Unit erworben werden musste. Weiterhin kann die 3D-Brille direkt an die einem Kopfhöreranschluss ähnelnde Buchse des asiatischen Master Systems angeschlossen werden, ein Adapter für den Kartenslot ist nicht notwendig. Mark III und das japanische Master System benutzen gemeinsam ein anderes Modulformat, welches nicht kompatibel zu amerikanischen/europäischen Konsolen ist. Des Weiteren existieren Prototypen von Discsystem (ähnlich dem Famicom Disk System) und einem Graphic Board.[1] Im Februar 1989 erschien mit Bomber Raid das letzte Spiel für diese Region.
Nordamerika
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]In Nordamerika verkaufte sich das Master System nur sehr langsam. Innerhalb der ersten vier Monate wurden 125.000 Konsolen verkauft. In derselben Zeit gingen rund 2.000.000 NES-Konsolen über die Ladentheke.
Nintendo hatte zu dieser Zeit 90 % des nordamerikanischen Marktes inne. Hayao Nakayama, damaliger CEO von Sega, entschied, keinen zu großen Aufwand auf vom NES dominierten Märkten zu betreiben. 1988 wurden die Master-System-Rechte in Nordamerika an Tonka verkauft, aber seine Popularität nahm weiterhin ab. 1990 hatte Sega Erfolg mit seinem Sega Mega Drive/Sega Genesis und kaufte die SMS-Rechte von Tonka zurück. Man entwickelte mit dem Sega Master System II eine kleinere, kostenreduzierte Version. Zudem war das Spiel Alex Kidd in Miracle World bereits integriert, so dass kein zusätzliches Modul gekauft werden musste. Später wurde es durch Sonic the Hedgehog ersetzt.
Um 1992 waren die Master-System-Verkäufe in Nordamerika praktisch nicht mehr existent und die Produktion wurde eingestellt. Durch den ausgebliebenen Erfolg erschienen lediglich 115 Titel für die Konsole.
Europa
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]In Europa wurde das Master System von Sega in vielen verschiedenen Ländern vermarktet, darunter sogar einige, in denen Nintendo keine Konsolen verkaufte. Europäer gewährten dem SMS breite Third-Party-Unterstützung, so dass es das NES in diesem Markt übertraf. Nintendo war gezwungen, Lizenzen für einige beliebte SMS-Titel in diesem Markt zu erwerben. Bis 1994 war das Master System die Konsole in Europa mit der größten Installationsbasis von 6,25 Mio. Geräten.[2] Die offizielle Unterstützung wurde 1996 eingestellt zugunsten des bereits in der Produktion befindlichen Sega Saturn. Das letzte europäische Spiel „Les Schtroumpfs Autour du Monde“ wurde nur noch in sehr geringen Mengen hergestellt, weshalb es unter Sammlern hoch gehandelt wird.
Australien
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Das SMS unterlag dem NES in Australien, jedoch war die Niederlage nicht so vernichtend wie in Nordamerika. Hier übernahm die hiesige Firma OziSoft den Vertrieb, bis sie schließlich 1992 von Sega übernommen wurde.[3] Die Hardware war identisch mit der europäischen Version.
Taiwan
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]In Taiwan setzte Aaronix den Vertrieb von Spielekonsolen aus dem Hause Sega fort.
Südkorea
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Aufgrund der vorherrschenden Vorbehalte gegenüber japanischen Firmen übernahmen koreanische Firmen die Vermarktung. Anders als beim Mark III, welches durch Korea Oacs Co. Ltd. vertrieben wurde, erschien das Master System in Südkorea ab 1989 als Samsung Gam*Boy (ab 1992 Aladdin Boy). Dieser übernahm dabei weitgehend das Design der japanischen Version, in einigen Varianten wurde die FM-Unit weggelassen.[4] Zudem wurde der Controller der hauseigenen SPC-Computerreihe verwendet, der ein Steuerkreuz, rechteckige Aktionstasten und ein abgerundetes Gehäuse besaß. Einige bekannte MSX-Konvertierungen erschienen dort, wie Gradius und der Super-Mario-Bros.-Klon Super Boy. Besonders aktiv war dabei die dort ansässige Firma Zemina.
Brasilien
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Brasilien war einer der erfolgreichsten Märkte für das SMS. Es wurde dort von TecToy, Segas brasilianischem Vertrieb, verkauft. Neben dem Master System 1 erschien auch das Master System 2 im gleichen Gehäuse wie sein Vorgänger, weshalb auch eine RGB-Buchse und ein Kartenslot integriert ist. Ein Sega Master System III (und sogar ein halb-tragbares SMS VI) erschien(en) auf diesem Markt, und mehrere Spiele wurden für die Kunden in Brasilien ins Portugiesische übersetzt. Die Figuren dieser Spiele wurden dem brasilianischen Publikum angepasst, zum Beispiel wurde Wonder Boy in Monster Land zu Mônica, der Hauptfigur eines beliebten brasilianischen Kinderbuches von Mauricio de Sousa.
Später wurden in Brasilien auch Game-Gear-Spiele für das dortige Master System konvertiert. Außerdem erschienen auch mehrereeigenen brasilianische Titel für das System. TecToy produzierte auch eine lizenzierte Version des beliebten Kampfspiels Street Fighter II für das Master System in Brasilien.
Das Sega Master System wurde in Brasilien bis über das Jahr 1996 hinaus produziert. Hinsichtlich des Designs ist die Version „Master System III Collection“ genauso gestaltet wie das nordamerikanische Master System II (Master System III in Brasilien). Im Unterschied dazu ist es aber weiß und wird mit 74 eingebauten Spielen auf einer internen ROM ausgeliefert. Außerdem gibt es das Master System „Collection Super Compact“, das sogenannte Super Compact Girl (in pink) und ein Master System Handy (eine Konsole ohne Modulschacht mit 27 implementierten Spielen) und das Master System Collection 105, identisch mit dem Collection 74, aber mit 105 implementierten Spielen im ROM (u. a. dem vorher unveröffentlichten Woody Woodpecker). Die aktuelle Fassung, Master System Evolution (Stand: 2023),[5] enthält 132 Spiele. Neben Klassikern wie Sonic und Alex Kidd finden sich auch zahlreiche, von TecToy entwickelte Spiele wie Cava Cava oder Resta Um in der Sammlung.
Sega Master System II & III
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Beim Master System II handelt es sich im Wesentlichen um ein Redesign der ursprünglichen Konsole. Aus Kostengründen verzichteten die Entwickler jedoch auf den Schacht für Steckkarten (Sega Card), die Reset-Taste, die Power-LED und den RGB-Anschluss. Es wurde in seiner Geschichte mehrmals verändert. Die Änderungen betrafen jedoch hauptsächlich das Design der Konsole. Im Master System 2 war das Spiel „Alex Kidd in Miracle World“ oder „Sonic The Hedgehog“ integriert.
Die Konsole besitzt lediglich einen Modulschacht für Spiele, die als Spielmodule veröffentlicht wurden (Mega-Cartridge). An der Konsole selbst ist eine Pausetaste und der Ein-/Ausschalter angebracht.
Die überarbeiteten Modelle kamen mit Ausnahme von Japan weltweit auf den Markt. In Korea ist diese Version unter den Namen Gam*Boy II / Aladdin Boy bekannt.
Das Master System III Compact wird bis heute von TecToy exklusiv für den brasilianischen Markt produziert. Die ersten Versionen entsprachen weitgehend dem Master System II. Später wurde das System jedoch mehrmals verändert und in unterschiedlichen Varianten angeboten, beispielsweise als kompakte Version mit eingebauten Spielen und ohne Modulschacht.
Zubehör
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Zur Steuerung der Spiele wird ein Controller mit 2 Tasten verwendet, wobei Taste 1 gleichzeitig als Starttaste dient. Andere kompatible Controller wie vom Mega Drive (welche übrigens im Lieferumfang späterer Aladdin Boys und TecToy-Versionen waren bzw. sind) oder von Atari können ebenfalls verwendet werden. Bis zu zwei Controller können an die Konsole angeschlossen werden. Die Drittfirma WKK bot einen kabelloser Infrarot-Controller an, seitens Sega existierten ein Arcade-Joystick (Control Stick), Trackball (Sports Paddle nur in Japan und Nordamerika), Lenkrad (Handle Controller) und in Japan ein Paddle-Control. Als weiteres Zubehör wurden ein Light Phaser und ein Adapter samt 3D-Brille, welche allerdings nur auf dem Master System 1 genutzt werden kann (Anschluss erfolgt über den Sega-Card-Slot), angeboten. Im japanischen Master System wurde der Adapter in der Konsole integriert. Dauerfeuer konnte über einen Adapter, der Rapid Fire Unit, oder einen nur in Europa und Japan erhältlichen Controller (SG Commander) realisiert werden. Ein Action Replay bot die Möglichkeit der Manipulation von Spieldaten. Zudem wurde exklusiv für japanische Konsolen eine TV-Erweiterung, das Telecon Pack, angeboten, welches drahtlos das TV-Signal übertrug.[6] Diese Technik fand auch Verwendung im Master System Super Compact des Herstellers TecToy.[7]
Hardware-Emulation
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Über den Power Base Converter lassen sich Spiele auf dem Mega Drive wiedergeben. Der Master Gear Converter ermöglicht die Wiedergabe auf dem Game Gear.
Technische Daten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- CPU: mit 3,55 (PAL/SECAM) bzw. 3,58 (NTSC) MHz getakteter Z80 (8-Bit-CPU)
- Grafik: ein vom Texas Instruments TMS9918 abgeleiteter VDP (Video Display Processor)
- 128 KBit (16 KByte) ROM
- 64 KBit (8 KByte) RAM (einige Cartridges erweitern diesen)
- 128 KBit (16 KByte) Video-RAM
- bis 32 Farben gleichzeitig aus zwei Paletten von 64 Farben (Paletten für Hintergrund & Sprites getrennt, inoffiziell mit speziellen Programmiertricks auch 64 Farben)[8]
- 256×192 und 256×224, bei PAL/SECAM auch 256×240 Pixel Bildschirmauflösung
- 8×8 Pixel Zeichen, maximal etwa 488 (unkomprimiert, begrenzte VRAM-Kapazität)
- 8×8 oder 8×16 Pixel Sprites, maximal 64 gleichzeitig
- ganzer oder teilweiser Bildschirmverschub (Scrolling) in horizontaler, vertikaler und diagonaler Richtung
- Musik: Texas Instruments SN76489 4-Kanalton (mono)
- beim japanischen Master System zusätzlich mit YM-2413, beim Mark III über FM-Unit
- Der SN76489 implementiert einen Rauschgenerator sowie 3 Soundgeneratoren, die einen Frequenzbereich von 122 Hz bis etwa 12,5 kHz abdecken können.
- Der YM-2413 hat 9 Monokanäle
- Expansion-Port: beim SMS 2 fehlt der Zugang
- Videoausgang (nicht beim SMS 2), Antennenanschluss
- Pause-Schalter an der Konsole, Reset-Schalter fehlt am SMS 2
- Modul-Slot, Karten-Slot/fehlt am SMS 2
- BIOS prüft Region und Checksumme[9]
Spiele
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Im Gegensatz zu der damaligen Nintendo-Politik konnten auch Dritthersteller Einfluss auf das Design der Module nehmen. So unterscheiden sich einige Module von Codemasters durch eine andere Form, welches eine farbige Abbildung erlaubte, wie sie bereits bei Mark-III-, Gam*Boy- und Sega-Card-Titeln existierten.
Für das Master System erschienen einige teilweise exklusive Titel, die von Bedeutung für die Videospielgeschichte sind. Phantasy Star war eines der ersten seiner Art und eines der ersten japanischen Rollenspiele (JRPG).[10]
Auszug
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bereits im ROM der Konsole integriert befand sich eines der folgenden Spiele: Alex Kidd in Miracle World, Sonic The Hedgehog, Snail Maze, Astro Warrior, Hang-On/Safari Hunt, Missile Defense 3D.

- Alex Kidd in Miracle World
- Fantasy Zone
- Hang-On
- Out Run
- Phantasy Star
- Power Strike
- Sonic the Hedgehog
- The Lucky Dime Caper – Starring Donald Duck
- Wonder Boy
- Wonder Boy III: The Dragon’s Trap
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Übersicht aller für das Master-System erschienenen Spiele
- Sammlung mit vielen Raritäten
- Fanpage über das Sega Master System (englisch)
- Fanpage die sich der Technik der Sega 8-Bit-Konsolen widmet (englisch)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Sega Graphic Board. Abgerufen am 2. Juni 2015 (portugiesisch).
- ↑ Jimmy Russell: 101 Amazing Sega Master System Facts
- ↑ OziSoft auf SegaRetro. Abgerufen am 28. Juni 2015 (pt-EN).
- ↑ Zwei Versionen des Gam*Boy. Abgerufen am 28. Juni 2015 (pt-EN).
- ↑ Master System Evolution Blue: MS 132. Abgerufen am 31. Juli 2023 (brasilianisches Portugiesisch).
- ↑ Telecon Pack. In: Maxim’s World of Stuff. Abgerufen am 25. August 2015.
- ↑ Master System Super Compact. Abgerufen am 25. August 2015.
- ↑ How To Program :: Palette. In: Maxim’s World of Stuff. Abgerufen am 17. März 2015.
- ↑ BIOSes. In: SMS Power! Abgerufen am 17. März 2015.
- ↑ Brian J. Wardyga: The Video Games Textbook. History. Business. Technology. CRC Press, Boca Raton 2019, ISBN 978-0-8153-9091-6 (englisch, eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
Konsolensysteme: SG-1000 (1982) | Sega Master System (1986) | Sega Mega Drive (1989) | Sega Multi-Mega (1992/93) | Sega Mega-CD (1992/93) | Sega 32X (1994) | Sega Saturn (1994) | Dreamcast (1999) | Sega Mega Drive Mini (2019) | Sega Mega Drive Mini 2 (2022)
Handgeräte: Sega Game Gear (1990) | Sega Mega Jet (1994) | Sega Nomad (1995) | Sega Retro Gen (2009)
Sega Saturn
Der Sega Saturn (japanisch .mw-parser-output .Kana{font-size:120%}セガサターン, Sega Satān) ist eine stationäre Spielkonsole des japanischen Unternehmens Sega, die erstmals am 22. November 1994 in Japan veröffentlicht wurde.
Einführung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Zum Ende der 16-Bit-Konsolenära hatte Sega weltweit hinter Nintendo den zweiten Platz im Konsolengeschäft inne. Der Veröffentlichungstermin für Nintendos Nachfolger für das Super Nintendo Entertainment System, das spätere Nintendo 64, verschob sich immer weiter nach hinten, so dass Sega mit dem Mega-Drive-Nachfolger Saturn eine gute Chance hatte, sich besser am Markt zu positionieren. Da sich mit Sonys PlayStation ein starker Marktmitbewerber etablierte, konnte Sega diese Erwartung nicht erfüllen.
Im Mai 1995 startete Sega den Saturn in den Vereinigten Staaten, ganze sechs Monate früher als geplant. Dies wurde auf der Electronic Entertainment Expo (E3) im selben Jahr angekündigt, wo die Sega-Vertreter sich ein Werbegefecht mit Sony lieferten. Dieser überraschende Schritt hatte jedoch magere Verkäufe zur Folge. Dies lag größtenteils am hohen Preis des Systems und dem Mangel an erhältlicher Software. Folglich beschloss Sega, Saturn-Einheiten nur noch an ausgewählte Händler auszuliefern. Dies sorgte für große Verbitterung seitens bestimmter Firmen, darunter Kay-Bee Toys.
1996 erschien eine Peripherie namens Sega NetLink (ein 28,8-kB/s-Modem, das als Steckmodul eingebracht wurde). Eigentlich zur Rettung der Konsole gedacht, erwies es sich eher als kontraproduktiv, da es einen hohen Preis und nur wenige kompatible Spiele hatte. Ein Webbrowser war mit dem Gerät erhältlich, programmiert von PlanetWeb, dem späteren Programmierer des Dreamcast-Browsers. Es wurde auch ein Maus- und Tastaturadapter für den NetLink angeboten. Dennoch wurden nur sehr wenige Einheiten verkauft.
In Japan wurde die Konsole durch eine Reihe von Fernsehspots beworben, die einen Helden zeigte, der Jugendliche mit Gewalt dazu anhielt, Sega Saturn zu spielen „bis die Knöchel bluten“. Die Spots orientierten sich dabei in Tonfall und Ästhetik an klassischen japanischen Kampfkunstfilmen. Der Held, Segata Sanshirō, wurde im Laufe der Kampagne zu einem Pop-Phänomen, das Lied der Werbespots, Sega Saturn, shiro! (セガサターン、シロ! .mw-parser-output .Latn{font-family:"Akzidenz Grotesk","Arial","Avant Garde Gothic","Calibri","Futura","Geneva","Gill Sans","Helvetica","Lucida Grande","Lucida Sans Unicode","Lucida Grande","Stone Sans","Tahoma","Trebuchet","Univers","Verdana"}Sega Satān, shiro!), als CD-Single veröffentlicht.
Technik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Hardware des Saturn, mit zwei Hauptprozessoren und sechs weiteren Prozessoren, machte es schwer, die maximale Leistung der Konsole voll auszunutzen, da das Parallel-Design für viele Spieleentwickler zu komplex war und auch noch heute ist. Yū Suzuki soll über die Schwierigkeiten, zwei Hauptprozessoren zu programmieren, gesagt haben:
„Die Prozessoren starten zwar gleichzeitig, dennoch gibt es Verzögerungen, wenn der eine darauf warten muss, dass der andere aufholt. Ich hätte einen einzelnen sehr schnellen Hauptprozessor bevorzugt. So denke ich, dass nur einer von hundert Entwicklern den Saturn richtig schnell zu programmieren versteht.“
Spielentwicklungen von anderen Herstellern wurden zudem dadurch gehemmt, dass keine brauchbaren Software Development Kits (Entwicklerumgebungen) verfügbar waren. Daher mussten viele Saturn-Spiele in Assemblersprache geschrieben werden, um eine angemessene Leistung mit der Hardware zu erzielen – eine ausgesprochen mühsame Entwicklungsweise. Häufig benutzten die Programmierer nur einen Hauptprozessor, um Schwierigkeiten beim Programmieren für den Saturn aus dem Weg zu gehen.
Der Saturn geriet bald gegenüber der PlayStation ins Hintertreffen; obwohl er über mehr als die doppelte Polygonleistung verfügte, wurde diese Leistung wegen Programmierschwierigkeiten nur selten erreicht. Im 2D-Bereich gehörte der Sega Saturn allerdings lange Zeit zur Oberklasse – dank der Fähigkeit einiger Spiele, auf die 4-MiB-RAM-Erweiterung zuzugreifen.
Es wurde ein spezielles Digitales Rechtemanagement (DRM) verwendet, das erst im Jahr 2016 geknackt wurde.[2] Bis dahin konnte er lediglich mittels eines Modchips oder spezieller Importmodule (mit denen auch Importspiele, die andere Regionalcodes verwenden, gespielt werden können) umgangen werden. Eine weitere Möglichkeit besteht im schnellen Wechseln einer Original-CD gegen eine gebrannte. Dabei wird das System mit der gebrannten gestartet. Fährt der Laser nach außen, um den Kopierschutz der CD und somit die Echtheit zu prüfen, wird die CD bei geöffneter Lade und laufendem Saturn gegen ein Original ausgetauscht. Fährt der Laser wieder zurück, muss die gebrannte Version wieder eingelegt werden. Man nennt dies „Swap-Technik“.
Spiele
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Der Sega Saturn wurde ursprünglich als ultimative 2D-Konsole entwickelt, wurde aber zwecks besserer 3D-Fähigkeiten überarbeitet, als sich Gerüchte um die PlayStation verbreiteten. Anschließend wurde der Saturn übereilt auf den Markt geworfen, um einen Vorsprung vor den Mitbewerbern zu haben – dadurch waren beim Verkaufsstart nur sehr wenige Spiele erhältlich.
Es wird allgemein angenommen, dass der Erfolg der PlayStation von den riesigen Marketingkampagnen abhing, die Sony startete. Sega als reines Videospiel-Unternehmen konnte in diesem Punkt nicht mit dem riesigen Konzern Schritt halten. Außerdem hatte Sega mit Entwicklern zu kämpfen: Core Design zum Beispiel, die Macher der Tomb-Raider-Reihe, entwickelten nach den recht enttäuschenden Verkäufen von Tomb Raider für den Sega Saturn keine Fortsetzungen mehr, was einen herben Schlag für Sega bedeutete. Westliche Software-Häuser konvertierten zwar Titel, blieben dem Saturn aber größtenteils fern.
Obwohl der Saturn in Japan erfolgreicher als der Vorgänger Mega Drive war, war er auf dem nordamerikanischen und dem europäischen Markt größtenteils ein Fehlschlag, wofür eine Vielzahl von Gründen in Frage kommt. Einer der vielleicht bedeutendsten war das Misstrauen, das die Spieler gegenüber Sega entwickelten, nachdem eine Reihe von Zusatz-Peripherien für den Mega Drive erschienen waren, die nach mäßiger Unterstützung fallengelassen wurden. Dazu zählten das Sega Mega-CD und das Sega 32X. Die Sony PlayStation hatte außerdem viele beliebte Softwaretitel früher im Rennen als Sega, ausgenommen Tomb Raider, das tatsächlich zuerst auf dem Saturn erschien. Auch die Kosten waren ein Faktor, denn der Saturn kostete anfangs 400 US$ – im Gegensatz zur PlayStation, die 300 US$ kostete. In diesem Zusammenhang ist auch zu erwähnen, dass die PlayStation relativ einfach für Schwarzkopien umgerüstet werden konnte, was beim Saturn zwar theoretisch auch möglich, aber dennoch deutlich komplizierter war.
Der Saturn gilt unter Fans bis heute als Kultkonsole. Obwohl die Umsetzungen von bekannten Spielhallentiteln wie Daytona USA oder der Virtua-Fighter-Serie heute als 3D-Pionierarbeit gelten, blieb der Saturn damals bis zu seinem Ende im Schatten der PlayStation. Die Hardware konnte mit luxuriösen, aber auch teuren Merkmalen aufwarten, die den PlayStation-Käufern verwehrt blieben (interner Speicher, MPEG-Unterstützung – die es möglich machte, Video-CDs wiederzugeben; RAM-Erweiterung). Es erschienen auch einige wenige Exklusivtitel, die heute unter Fans Kultstatus genießen (NiGHTS into Dreams, Panzer Dragoon, Sega Rally). Was fehlt, sind die großen Namen und Helden von Nintendo, Sony und deren Alternativherstellern.
1998 erschien das Spiel Deep Fear in Europa als letzter Titel für den Saturn. In Japan hingegen erfreute sich der Saturn auch weiterhin großer Beliebtheit, was nicht zuletzt auf die große Masse an Rollenspielen zurückzuführen ist, von denen viele nicht bis nach Europa kamen.
Modelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Es gab mehrere Modelle des Saturn. Das erste Modell mit ovalen Schaltern wurde nach einiger Zeit durch ein zweites mit runden Schaltern ersetzt. Zusammen mit dem zweiten Modell wurde auch ein überarbeitetes Gamepad ausgeliefert. In Europa, Australien, Kanada und den USA waren die Konsolen schwarz, auf dem japanischen Markt dagegen weiß und grau. Einige andere Farbversionen erschienen in limitierter Auflage in Japan: Der Skeleton „Cool“ Saturn mit einem graugetönten halbtransparenten Gehäuse und der Saturn Derbysta mit halbtransparentem bläulichen Gehäuse mit dem Logo des Pferderennspiels Derby Stallion.
Zudem wurden in Japan die Konsolen auch von anderen Herstellern gebaut, wie der JVC/Victor V-Saturn und der HiSaturn von Hitachi. In Korea wurden einige Konsolen von Samsung gefertigt.
Außerdem wurden für Frankreich Konsolen für die dortige SECAM-Norm produziert, bei denen es sich jedoch eigentlich um PAL-Geräte mit einem Konverter handelte, der die Videosignale umwandelte.
Technische Daten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Hauptprozessoren
- Zwei (Master+Slave) SH-2 7604 32-Bit-RISC-Prozessoren mit je 28,6 MHz (je 25 MIPS) – mit jeweils 4 kB „on-chip“-Cache, davon 2 kB als direkt adressierbares RAM benutzbar
- SH-1 32-Bit-RISC-Processor, 20 MHz (20 MIPS), zur Kontrolle des CD-ROM-Laufwerks
- Saturn Control Unit (SCU) DMA-Controller zur Verbindung der drei Busse und Verarbeitung von Geometrie. 32-Bit bei 14,3 MHz
- Hitachi 4-Bit-MCU, „System Manager & Peripheral Control“ (SMPC)
Video
- VDP1, 32-Bit-Video-Display-Prozessor
- Sprite-, Polygon- und Geometrie-Engine (4-eckige Polygone)
- Dual 256 kB Frame Buffer für Rotations- und Scaling-Effekte
- Texture Mapping
- Gouraud Shading
- 512 KB Cache für Texturen
- VDP2, 32-Bit-Background-und-Scroll-Plane-Video-Display-Prozessor, lineare Transformation und Ausgabe
- Background Engine vergleichbar, aber leistungsfähiger als Mode 7 des SNES
- Fünf gleichzeitig scrollende Hintergründe
- Zwei gleichzeitig zoomende/rotierende Spielebenen
- 200.000 textur-gemappte Polygone pro Sekunde
- 500.000 flat-shaded Polygone pro Sekunde
- 60 Animations-Frames pro Sekunde
- 24-Bit-True-Color-Grafik
- 16,7 Millionen Farben
- Auflösungen: 352 × 240, 640 × 240 und 704 × 480 Pixel
- Programmierbare Anzeigenauflösungen: (Horizontale Größen von 320, 352, 640, 704 Pixeln), (Vertikale Größen von 224, 240, 256 scanlines, non-interlaced), (Vertikale Größen von 448, 480, 512 scanlines, interlaced), nur PAL-Konsolen unterstützen Scanlineanzeigen von 256 und 512
- 7,1590 MHz Taktrate bei NTSC-Systemen, 6,7116 MHz für PAL-Systeme
Audio
- Yamaha FH1 Digital-Signal-Prozessor (DSP) mit 22,6 MHz
- Motorola 68EC000 Sound-Prozessor mit 11,3 MHz (1,5 MIPS)
- 32 Kanäle für PCM (pulse-code modulation) oder FM (frequency modulation) Sound
- Beliebig viele der 32 Kanäle können verbunden werden für mehrere Operatoren pro FM Sound-Kanal
- Normalerweise wurden vier Operatoren pro Kanal für 8 FM-Kanäle insgesamt genutzt
- 44,1 kHz Sampling-Rate
- 16-Bit-Stereo-DAC
Speicher
- 2 MB RAM (zwischen beiden CPUs und der SCU geteilter Hauptspeicher)
- 1,54 MB Video-RAM
- 512 kB Audio-RAM
- 512 kB CD-ROM Cache
- 32 kB RAM (battery backup), als Massenspeicher (Spielstandspeicherung, High Scores etc.)
Medien
- Double-Speed-CD-ROM (320 KB/s Übertragungsgeschwindigkeit)
- Audio-CD-kompatibel
- CD+G-kompatibel
- CD+EG-kompatibel
- CD single (8 cm CD)-kompatibel
- Video-CD (MPEG1), optional
- Photo CD, optional (durch extra Software)
- Electronic Books, optional (durch extra Software)
- Digital Karaoke, optional
- 512 kB Memory-Cartridges für Spielstandsicherung, optional
Eingabe und Ausgabe
- High-Speed-Serial-Communications-Port
- Interner 32-Bit-Expansion-Port
- Interner Multi-AV-Port für Video-CD-Adapter
- Composite video/stereo (Standard)
- NTSC/PAL/SECAM RF (optional)
- S-Video-kompatibel (optional)
- RGB-kompatibel (optional)
- Hi-Vision (EDTV) und 31 kHz (VGA) Anzeige: (31 kHz: 320 × 480 oder 640 × 480, non-interlaced), (Hi-Vision: 352 × 480 oder 704 × 480, non-interlaced) Benötigt kompatiblen Monitor und Video-Kabel (optional)
- Analoges Control-Pad optional
- Zwei Control-Pad-Anschlüsse
Stromversorgung
- AC120 Volt; 60 Hz (US/CAN)
- AC240 Volt; 50 Hz (EU/AUS)
- AC100 Volt; 50/60 Hz (JP)
- 3-Volt-Lithiumbatterie (CR 2032) zum Antreiben des permanenten RAM- und SMPC-internen Realzeittaktgebers
Fernsehnormen
- NTSC-J (JP)
- NTSC-US (US/CAN)
- PAL (EU/AUS)
- SECAM (F)
Stromverbrauch
- ca. 25 W
Größe (Europa-/US-Modell)
- Breite: 260 mm (10,2″)
- Tiefe: 230 mm (9,0″)
- Höhe: 83 mm (3,2″)



Zubehör
- Digital-Gamepad (8-Wege-Pad, 6 Knöpfe)
- Analog-Gamepad „Thumbpad“ (eingeführt mit Spiel NiGHTS Into Dreams und sah dem späteren Dreamcast-Controller bereits sehr ähnlich)
- „Stunner“-Lightgun (eingeführt mit Spiel Virtua Cop)
- Multitap (Mehrspieleradapter)
- „Arcade Racer“-Lenkrad
- Netlink-Modem-Karte
- Netlink-PS/2-Keyboard-Adapter (zu Benutzen mit Netlink-Modem)
- 1,44 MB-3,5″-Disketten-Laufwerk (serielle Schnittstelle, nur durch wenige Spiele unterstützt)
Emulatoren
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Es existieren verschiedene Emulatoren des Sega Saturns, zum Beispiel Satourne, Saturin, SSF und Yabause.
Auf dem Polymega werden ebenfalls Saturn-Spiele emuliert.
Auch gibt es Emulatoren, die auf dem Saturn andere Systeme emulieren, z. B. Game Boy, Atari Lynx, WonderSwan Color oder SNES.
Sonstiges
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sega plante, auch Spiele für den Saturn vereinzelt als Modul zu veröffentlichen, um bei Spielen die Ladezeiten wegfallen zu lassen und so einen ununterbrochenen Spielablauf zu ermöglichen. Dies wurde indirekt auch durchgeführt mit Spielen wie King of Fighters 95 oder Ultraman. Diese Spiele hatten die eigentliche Software auf ROM-Modulen, während die Musik von der CD geladen wurde, allerdings kann das Spiel nur mit der CD zusammen gestartet werden. Spätere Spiele wurden aus Kostengründen statt mit einem ROM-Modul, das die eigentliche Software enthielt, mit einem RAM-Modul (1, 2 oder 4 MB) ausgeliefert. Beim Start des Spiels wurde der Programmcode dann in das Modul geladen und, abgesehen von der Musik, von dort aus geladen, was zu erheblichen Verkürzungen der Ladezeiten führte. Vor allem Umsetzungen bekannter Neo-Geo-Spiele wie The King of Fighters, oder Capcoms Vampire-Savior-Spiele waren dank dieser Technik fast 1:1-Umsetzungen der Arcade-Originale, während Umsetzungen für die PlayStation nur mit Abstrichen möglich waren.
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Pixelor.de Hardware und Spiele des SEGA Saturn (archivierte Version)
- Vidgames.de Import-Tests für Saturn
- SEGA-Saturn.net Liste aller Spiele, des Zubehörs, Spielmusik, Werbung und mehr
- SEGA-Saturn-Spielarchiv - PAL (archivierte Version)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Sega Saturn History. In: sega-saturn.net. Abgerufen am 29. Oktober 2024.
- ↑ Merlin Schumacher: DRM des SEGA Saturn nach fast 22 Jahren umgangen. In: Heise online. 12. Juli 2016.
Konsolensysteme: SG-1000 (1982) | Sega Master System (1986) | Sega Mega Drive (1989) | Sega Multi-Mega (1992/93) | Sega Mega-CD (1992/93) | Sega 32X (1994) | Sega Saturn (1994) | Dreamcast (1999) | Sega Mega Drive Mini (2019) | Sega Mega Drive Mini 2 (2022)
Handgeräte: Sega Game Gear (1990) | Sega Mega Jet (1994) | Sega Nomad (1995) | Sega Retro Gen (2009)
Sega Dreamcast

Die Dreamcast (jap. .mw-parser-output .Kana{font-size:120%}ドリームキャスト, Dorīmukyasuto) ist die letzte Spielkonsole des japanischen Unternehmens Sega. Der Name Dreamcast setzt sich aus den englischen Wörtern Dream (Traum) und (Broad-)cast (Übertragen) zusammen, heißt also in etwa „Traumübertragung“. Das Logo (ein Wirbel, engl. „swirl“) soll die Erweiterbarkeit der Konsole symbolisieren. Die Herstellung der Spielkonsole wurde 2001 eingestellt, bis heute erscheinen neue Spiele, die von Fans programmiert werden („Homebrew“). Als Spielkonsole konkurrierte die Dreamcast mit der PlayStation 2 und dem Nintendo GameCube.
Geschichte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Entwicklung und Verkaufsstart
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Spätestens ab 1997 lag Sega mit dem Sega Saturn weit abgeschlagen auf dem dritten Platz im Spielkonsolenmarkt (hinter Nintendo 64 und PlayStation). Zu diesem Zeitpunkt begann man bei Sega mit der Entwicklung eines Nachfolgers. Zunächst arbeiteten zwei konkurrierende Teams gleichzeitig an einer neuen Plattform. Eines der Teams wurde von Tatsuo Yamamoto, einem Entwickler bei IBM, geleitet, das andere Team, Segas interne Entwicklungsabteilung, wurde von Hideki Sato geleitet.

Sato und sein Team entschieden sich, für die neue Plattform einen Hitachi SH4-Prozessor und einen VideoLogic PowerVR2-Grafikprozessor zu verwenden. Yamamotos Gruppe entschied sich ebenfalls für einen SH4-Prozessor, allerdings beschloss er, 3dfx-Grafikhardware anstatt des PowerVR2 einzusetzen.
Anfangs bevorzugte man bei Sega den Prototyp von Tatsuo Yamamoto mit dem 3dfx-Grafikchip, entschied sich aber letztendlich für den Entwurf von Hideki Sato. 3dfx, die schon mit dem Auftrag gerechnet hatten, verklagten später SEGA wegen dieses Schritts. Der Rechtsstreit wurde jedoch beigelegt.[2][3] Für die neue Konsole wurde auch ein eigenes optisches Speichermedium entwickelt, die GD-ROM, sie konnte aber auch handelsübliche CDs lesen.
Zunächst war die Konsole unter verschiedenen Arbeitstiteln bekannt, u. a. „Guppy“, „Katana“, „Dural“ oder „Black Belt“, bis man sich letztlich für Dreamcast entschied.
Entwickler hatten später auch die Auswahl zwischen zwei verschiedenen Dreamcast-Betriebssystemen: einem von Sega selbst entwickelten System, Katana, und einer eigens von Microsoft auf Dreamcast portierten Version von Windows CE, die auch DirectX unterstützte.[4] Das Katana-System wurde meist von Exklusivtiteln verwendet, während Windows CE meist bei Portierungen von PC-Spielen zum Einsatz kam. Die beiden Systeme waren aber nicht, wie oft vermutet, in der Konsole selbst enthalten, sondern auf der GD-ROM des jeweiligen Spiels.
.mw-parser-output .vl-mehrere-bilder{margin-top:.5em}.mw-parser-output .vl-mehrere-bilder-kopf{clear:both;font-weight:bold}.mw-parser-output .vl-mehrere-bilder-horizontal{float:left;padding:1px}@media screen{html.skin-theme-clientpref-night .mw-parser-output .vl-mehrere-bilder .thumbimage{background:none}html.skin-theme-clientpref-night .mw-parser-output .vl-mehrere-bilder .thumbimage:not([style*="background"]) span:not([class]) img{background-color:var(--background-color-base-fixed,#ffffff);color:var(--color-base-fixed,#202122);filter:brightness(0.8)}}@media screen and (prefers-color-scheme:dark){html.skin-theme-clientpref-os .mw-parser-output .vl-mehrere-bilder .thumbimage{background:none}html.skin-theme-clientpref-os .mw-parser-output .vl-mehrere-bilder .thumbimage:not([style*="background"]) span:not([class]) img{background-color:var(--background-color-base-fixed,#ffffff);color:var(--color-base-fixed,#202122);filter:brightness(0.8)}}Die Dreamcast wurde schließlich am 27. November 1998 in Japan veröffentlicht, am 9. September 1999 in Nordamerika und am 14. Oktober 1999 in Europa. Besonders in den USA war der Verkaufsstart sehr erfolgreich, dort wurden über 500.000 Grundgeräte binnen der ersten zwei Wochen verkauft. Bekannte Spiele, die von Anfang an verfügbar waren, waren unter anderem Soul Calibur, Sonic Adventure, Hydro Thunder und Power Stone. Bis Oktober 1999 wurden in Deutschland 41.412 Einheiten verkauft[5]
In den USA wurden bei der Markteinführung sämtliche Verkaufsrekorde gebrochen. Es gab 600.000 Vorbestellungen. Innerhalb der ersten 24 Stunden wurden fast 100 Millionen US-Dollar Umsatz gemacht und innerhalb weniger Wochen eine Million Konsolen verkauft.[6]
In Japan und den US-amerikanischen Märkten wurde Dreamcast unter einem orangefarbenen Symbol veröffentlicht, welches umgangssprachlich „Wirbel“ genannt wurde. Die europäische Version des Dreamcast-Wirbels wurde jedoch aufgrund rechtlicher Konflikte blau eingefärbt, denn der deutsche Verlag Tivola hat ein ähnliches orangefarbenes Unternehmenslogo.
Sega versuchte auch als Sponsor von Sportmannschaften den Namen Dreamcast bekannter zu machen. Die damalige Topmannschaft Deportivo La Coruña und der FC Arsenal London hatten unter anderem einen Dreamcast-Schriftzug auf den damaligen Trikots gedruckt.
Trotz des guten Starts konnte SEGA die hohen Dreamcast-Verkaufszahlen nicht halten. Besonders entwickelte sich die Situation für Sega zum Negativen, als Sony die PlayStation 2 veröffentlichte, die bereits zuvor gute Wertungen erhalten und für Medienrummel gesorgt hatte.[7][8][9][10] Die PlayStation 2, die technisch die Dreamcast übertreffen sollte und mit einem DVD-Laufwerk eine wichtige Funktion enthielt, dominierte von da an den Spielkonsolen-Markt. Im Mai 2000 waren in Japan bereits mehr PlayStation-2-Konsolen als Dreamcast-Geräte verkauft worden.[11] Die Dreamcast war zu diesem Zeitpunkt schon eineinhalb Jahre auf dem Markt, die PlayStation 2 nur etwa zwei Monate. Die Verkaufszahlen der PlayStation 2 betrugen teilweise mehr als das Zehnfache der Dreamcast-Verkäufe.
Diesem Erfolg Sonys konnte das ohnehin schon angeschlagene Sega mit der Dreamcast kaum etwas entgegensetzen. Inzwischen hatten Hacker auch eine Möglichkeit gefunden, mit einer speziellen über das Internet verbreiteten Boot-CD ohne Modchip oder sonstige Modifikationen Schwarzkopien auf der Dreamcast abzuspielen.[12] Die Produktpiraterie wurde zu einem ernsthaften Problem für SEGA.
Bis Ende 2000 fiel der Kurs der Sega-Aktien um 76 %,[13] das Unternehmen erwirtschaftete allein im ersten Halbjahr 2000 einen Verlust von fast 350 Millionen Euro.
Einstellung der Produktion
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Dreamcast-Verkäufe besserten sich auch nach dem missglückten Weihnachtsgeschäft 2000 nicht. Nach hohen Verlusten und weiterhin sinkendem Aktienkurs kündigte Sega schließlich im Januar 2001 an, dass die Dreamcast-Produktion bis März 2001 eingestellt werde.[14][15] Die etwa 100 noch in Entwicklung befindlichen Dreamcast-Spiele von SEGA und Drittherstellern sollten jedoch noch erscheinen. SEGA selbst wollte sich nun nach und nach ganz aus dem Konsolengeschäft zurückziehen und in Zukunft nur noch Software für Spielkonsolen anderer Hersteller produzieren. Viele noch in Entwicklung befindliche Dreamcast-Projekte erschienen nach dem Produktionsstopp nur noch für andere Plattformen oder wurden teils auch komplett eingestellt. Ein Teil dieser nicht mehr erschienenen Titel stand kurz vor der Fertigstellung, so etwa die Dreamcast-Version von Half-Life oder das Spiel Propeller Arena. Von letzteren beiden tauchten später spielbare Beta-Versionen im Internet auf.
Nach dem Produktionsende
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nach dem Ende der Produktion besserten sich infolge drastischer Preissenkungen auch in Europa die Verkaufszahlen der Restbestände. In Japan gelang jedoch aufgrund fehlender guter Rollenspiele, die für den japanischen Markt sehr wichtig sind, nie der große Durchbruch. Trotzdem wurden dort noch Jahre nach dem Ende der Produktion neue Dreamcast-Spiele entwickelt.
In Europa übernahm Bigben Interactive die Dreamcast-Restbestände und deren Vermarktung. Bigben bemühte sich, den europäischen Fans noch einige Spiele zu präsentieren, die von Sega ursprünglich nur noch für den japanischen Markt bestimmt waren. Dazu gehörten unter anderem Titel wie beispielsweise Shenmue II oder Rez. Im Jahr 2002 erschienen jedoch auch in Europa die letzten offiziellen Spiele.
Das kleine amerikanische Unternehmen bleem! brachte noch 2001 drei kommerzielle CDs des PlayStation-Emulators bleemcast! auf den Markt. Jede dieser CDs emuliert jeweils ein PlayStation-Spiel, es gab Versionen für Gran Turismo 2, Metal Gear Solid und Tekken 3. Ursprünglich hätte dieser Emulator in weiteren Versionen erscheinen sollen. Durch jahrelange Gerichtsprozesse mit Sony, dem Hersteller der PlayStation, wurde das Softwareunternehmen jedoch finanziell so schwer belastet, dass es sich 2001 auflösen musste. bleemcast! gehörte zu den ersten nicht von Sega lizenzierten Programmen auf Dreamcast und benutzte keinerlei Programmroutinen oder Bibliotheken von Sega. Es war komplett in Assemblersprache geschrieben und erschien auch auf CD-ROM, nicht Segas eigens entwickeltem Format GD-ROM.
Nur einige wenige kommerziell vertriebene Programme erschienen damals ebenfalls ohne Sega-Lizenz, unter anderem das Cheatmodul Codebreaker oder die MP3-Spieler Blaze DCMP3 und Pelican MP3.

In Japan, dem eigentlich schwächsten Markt für Dreamcast, entwickelten kleinere Unternehmen jahrelang neue Dreamcast-Titel, die auch noch offiziell von Sega lizenziert wurden. Diese wurden zu einem erhöhten Preis auch von nordamerikanischen und europäischen Fans importiert. Die meisten Titel dieser Ära stammten aus den Genres Shoot ’em up und Visual Novel. Einer der bekanntesten Dreamcast-Titel dieser Zeit ist Ikaruga.
Viele der Dreamcast-Spiele, die zwischen 2002 und 2007 erschienen, sind Portierungen von NAOMI-Spielen. Beim Sega NAOMI handelt es sich gewissermaßen um die Spielhallenversion der Dreamcast, die auch technisch weitgehend identisch mit dieser ist.
Dreamcast-Fans organisierten über das Internet mehrere Petitionen, die einige japanische Hersteller dazu bewegen sollten, ihre NAOMI-Spiele auch noch auf Dreamcast zu veröffentlichen (für die zahlreichen Aktivitäten der Fanbewegung, siehe den Abschnitt Die Dreamcast-Szene).
Einige Petitionen hatten Erfolg, so veröffentlichte das japanische Studio G.Revolution im Jahr 2003 eine Dreamcast-Version von Border Down (2003), einem äußerst erfolgreichen Spiel aus dem Genre der Shoot'em Ups.
Anfang 2003 wurde die Dreamarena, der Online-Service der Dreamcast in Europa, geschlossen. Einige Spiele, die nicht direkt an die Dreamarena-Server gebunden waren, wie etwa Phantasy Star Online, Quake III Arena oder Starlancer, sind jedoch bis heute online spielbar.
Auch Sega veröffentlichte 2004 in Japan überraschend noch ein allerletztes Dreamcast-Spiel, Puyo Pop Fever, das ebenfalls eine Konvertierung vom NAOMI-Automaten darstellte.
Im März 2006 brachte das japanische Studio G.Revolution mit Under Defeat einen weiteren Dreamcast-Titel auf den Markt und demonstrierte noch einmal eindrucksvoll, zu welchen grafischen Leistungen Segas letzte Konsole fähig ist.
In Japan wurden bis Anfang 2007 noch regelmäßig offiziell von Sega lizenzierte Dreamcast-Spiele veröffentlicht. Das endgültig letzte Dreamcast-Spiel, das noch eine offizielle Sega-Lizenz erhielt, war Karous, das am 8. März 2007 erschien. Zur gleichen Zeit wurde die Produktion von GD-ROMs eingestellt, sodass keine weiteren offiziellen Spiele mehr erscheinen konnten.[16] Sogenannte Independent-Veröffentlichungen, also Spiele ohne Sega-Lizenz und auf CD-ROM statt GD-ROM, sind davon jedoch nicht betroffen und können weiterhin erscheinen. Seit 2007 erschienen acht weitere, kommerzielle Dreamcast-Titel auf CD-ROM und es sind nach wie vor neue Titel in Entwicklung.[17]
Am 1. April 2007 wurden die offiziellen Server von Phantasy Star Online für Dreamcast abgeschaltet. Über private, von Fans betriebene Server lässt sich das Spiel jedoch weiterhin online spielen. Bemerkenswert sind hier die Server-Projekte SCHTHACK[18] und Sylverant,[19] über die Dreamcast-Spieler sogar mit Benutzern der PC-Version von PSO gemeinsam online spielen können.
Die Dreamcast-Szene
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Unabhängig von den japanischen Studios, die die Dreamcast bis etwa 2007 mit offiziell von Sega lizenzierten Spielen unterstützten, blieb die Dreamcast-Fangemeinde auch nach dem Ende der Dreamcast-Produktion im Internet bis heute aktiv. Amerikanische und europäische Entwickler versorgen seit dem Ende der GD-ROM-Produktion Anfang 2007 die Dreamcast mit neuen, auch weltweit vertriebenen Spielen. Daneben entwickelt eine Hobby-Entwicklerszene bis heute neue Freeware- und OpenSource-Programme für die Dreamcast. Es bildeten sich schon ab 2000 zahlreiche Internetforen und Communities, in denen sich Dreamcast-Fans bis heute organisieren.
Wie bei vielen anderen Konsolen gelang es Hackern schon früh, eigenen Programmcode, sprich selbstgeschriebene Programme, auf der Konsole abzuspielen. Anfangs lag das Augenmerk der Szene jedoch noch auf dem Ausführen von Schwarzkopien. Die im Juni 2000 über das Internet veröffentlichte Utopia BootCD der Warez-Gruppe „UTOPiA“ machte es möglich Dreamcast-Raubkopien ohne einen Modchip oder sonstige Modifikationen an der Konsole abzuspielen. Ab diesem Zeitpunkt wurde praktisch jedes neue Dreamcast-Spiel gecrackt und als Raubkopie im Internet veröffentlicht. Noch 2000 gelang es dann, Spiele auch ohne BootCD direkt auf der Dreamcast zu starten.

Dies eröffnete aber auch für Hobbyentwickler neue Möglichkeiten. Schon bald wurden von Freizeitentwicklern erste kostenlose, eigens für Dreamcast entwickelte Programme veröffentlicht (sogenannte Homebrew-Software). Die ersten Anwendungen dieser Art, wie etwa „GypPlay“, „DCMP3“ oder DCDivX ermöglichten es, Videos und MP3-Dateien auf der Dreamcast wiederzugeben. Über diese frühen Homebrew-Projekte für Dreamcast berichteten auch bekannte Technik- und IT-Medien, wie etwa Golem.de[20] oder die c’t.[21] Schon bald kamen auch erste Emulatoren für andere Systeme hinzu. Der erste, heute natürlich veraltete, Emulator für Dreamcast war „gleam!“, ein NES-Emulator.[22] Diese frühen Veröffentlichungen benutzten noch das Windows-CE-SDK von SEGA und Microsoft und befanden sich somit rechtlich gesehen in einer Grauzone.
Noch 2000 begannen einige Hobbyentwickler jedoch mit der Entwicklung kostenloser und legaler Entwicklerbibliotheken, die bekannteste und erfolgreichste davon ist das bis heute weiterentwickelte Open-Source-Projekt KallistiOS, es gab aber auch einige weitere, weniger bekannte Projekte in dieser Richtung. KallistiOS war so weit fortgeschritten, dass es ab 2003 auch in einigen kommerziellen Projekten verwendet wurde.
KallistiOS ermöglichte es Hobbyentwicklern, ihre Kreationen ohne rechtliche Bedenken zu veröffentlichen und zu verkaufen, da es keinerlei geschützten Programmcode von SEGA mehr benutzte. Die zweite Generation der Homebrew-Anwendungen für Dreamcast (ab 2001) verwendete fast durchgängig KallistiOS und war also aus rechtlicher Hinsicht bereits völlig legal. Hobbyprogrammierer konnten ihre Programme nun bedenkenlos über das Internet verbreiten. Dreamcast-Homebrew kann einfach auf CD gebrannt und auf der Konsole sofort gestartet werden. Die Tatsache, dass dafür keinerlei Modifikationen (wie etwa ein Modchip) nötig waren, machte die Konsole für Hobbyentwickler besonders interessant.
Insbesondere nach der Einstellung der Dreamcast-Produktion entwickelte sich Segas letzte Konsole dadurch zu einer äußerst beliebten Plattform für Hobbyprogrammierer. Den Höhepunkt erreichte die Hobbyentwicklerszene erst lange nachdem die großen Hersteller das Thema Dreamcast bereits abgeschrieben hatten.
Im Laufe der Jahre erschienen im Internet hunderte kostenlose Anwendungen. Das Themenspektrum der veröffentlichten Freeware-Programme ist riesig. Dazu zählen selbstentwickelte oder portierte Spiele, MP3-Player, Multimedia-Anwendungen, Webbrowser und Emulatoren für eine Unmenge an Systemen, unter anderem für Super Nintendo, Commodore 64, Atari 2600, Neo Geo, Amiga 500, MSX, NES, Mega Drive, Game Gear, Atari Lynx, Sega Master System und Atomiswave. Die Mehrzahl der Emulatoren funktioniert relativ gut und es lassen sich viele Spiele, die eigentlich für andere Systeme entwickelt wurden, ruckelfrei auf der Dreamcast wiedergeben. Daneben ist es auch möglich, VCDs und DivX-Filme auf der Dreamcast abzuspielen.

Es gibt außerdem zahlreiche Multiplattform-Projekte, wie beispielsweise das ScummVM-Projekt, mit dem man alte Adventures wie Sam & Max, Indiana Jones 3 und 4, Monkey Island 1 bis 3, Simon the Sorcerer 1 und 2 auf der Dreamcast spielen kann. Viele Spieleklassiker oder Open-Source-Spiele wurden ebenfalls auf Dreamcast portiert, wie etwa einige Ego-Shooter von id Software, Doom, Doom 2: Hell on Earth oder Wolfenstein 3D. Daneben gibt es auch viele eigens für Dreamcast entwickelte Freeware- oder OpenSource-Spiele, wie etwa das Alice Dreams-Projekt.[23]
Es gibt auch eine Dreamcast-Version des freien Betriebssystems Linux. Bis dato wurden mit NetBSD und QNX zwei weitere Betriebssysteme auf Dreamcast portiert. Daneben entwickelt ein russisches Team mit „DreamShell“ ein Betriebssystem, das ausschließlich für Dreamcast konzipiert wurde.
Die Dreamcast-Fanbewegung, oft als „Dreamcast-Szene“ bezeichnet, organisierte sich von Anfang an hauptsächlich über Webseiten, Internet-Foren und IRC-Chaträume, von denen viele noch heute existieren. Zu den bekanntesten, heute noch aktiven dieser Seiten gehören etwa Dreamcast-Scene, DCEmulation.org, DCEmu.co.uk (alle englischsprachig), SEGA-DC.DE (deutschsprachig), Dreamcast.es (spanisch), DreamAgain.fr (französisch), DC-SWAT.ru und Dreamcast.org.ru (beide russisch). Neben englischsprachigen Foren war auch die spanisch- und französischsprachige Dreamcast-Szene besonders stark. Etwas später bildeten sich dann auch große deutsch- und russischsprachige Communities heraus. Anders als oft vermutet, gab es aber relativ wenige japanische Homebrew-Entwickler in der Dreamcast-Szene. Die „Homebrew-Szene“ bestand und besteht auch heute noch überwiegend aus europäischen und amerikanischen Dreamcast-Fans. In den Jahren 2005, 2006 und 2007 wurde mit der „DreamCon“ zudem ein weltweites Treffen von Dreamcast-Szenern organisiert.[24]
Es fand auch ein kreativer Austausch zwischen der „Dreamcast-Szene“ und Angehörigen der Homebrew-Szene auf anderen Konsolen statt. Insbesondere mit der Hobbyentwicklerszene auf GP32, GP2X und GP2X Wiz gab und gibt es viele Verbindungen. Eine Vielzahl plattformübergreifender Projekte und die Zahl der Programmierer, die in beiden „Szenen“ aktiv waren, bestätigt dies.
Inzwischen entwickelten Fans auch einen SD-Karten-Adapter für Dreamcast, der ab 2010 in größeren Stückzahlen produziert wurde und seitdem über das Internet verkauft wird.[25] Viele Homebrew-Projekte unterstützen diesen Adapter mittlerweile.
Im Jahr 2003 wurde nach einer Welle an Freeware auch das erste kommerzielle und professionell gepresste Dreamcast-Spiel veröffentlicht, das nur von Angehörigen der Hobbyentwicklerszene entwickelt worden war. Das Spiel trägt den Namen Feet of Fury und ist ein Musikspiel. Dieser Titel war, im Gegensatz zu den damals in Japan noch erscheinenden Dreamcast-Spielen, nicht offiziell von SEGA lizenziert worden und erschien nicht auf GD-ROMs, sondern auf handelsüblichen CDs. Spiele ohne SEGA-Lizenz werden daher als Independent-Titel (kurz „Indie“) bezeichnet. Seit 2003 sind zahlreiche weitere Indie-Titel veröffentlicht worden.
Feet of Fury verwendete KallistiOS und konnte somit problemlos und legal vertrieben werden. Als Publisher agierte dabei GOAT Store Publishing, vormals nur ein Online-Shop, dessen Betreiber ebenfalls Anhänger der Dreamcast-Szene waren.
Der damals äußerst bekannte Online-Versand Lik-Sang unterstützte ebenfalls die Hobbyentwicklergemeinde und nahm Feet of Fury in sein Sortiment auf und schaltete Werbung für das Spiel. Bis Ende 2005 veröffentlichte GOAT Store drei weitere Spiele von semiprofessionellen Entwicklern, Maqiupai, Inhabitants und Cool Herders.
Im Januar 2007 ist das 2D-Shoot ’em Up Last Hope erschienen, entwickelt vom NG:DEV.TEAM aus Deutschland und vertrieben von redspotgames. Last Hope war der bis dato aufwändigste aber auch erfolgreichste Indie-Titel für Dreamcast. Last Hope erschien – wie alle Indie-Veröffentlichungen – ohne offizielle Lizenz von SEGA, wurde jedoch trotzdem weltweit vertrieben. Nachdem SEGA 2007 die Produktion neuer GD-Roms einstellte, werden seitdem nur noch Indie-Titel veröffentlicht. Der Münchner Videospiele-Publisher redspotgames, der schon Last Hope vertrieb und aus der Indie-Szene des Dreamcast hervorgegangen war, veröffentlichte bis Ende 2009 mit Wind & Water: Puzzle Battles (2008) und Rush Rush Rally Racing (2009) zwei weitere Dreamcast-Spiele – auf einem in der Indie-Szene bisher nicht dagewesenen Level an Professionalität.
Auch das deutsche Entwickler-Team HUCast veröffentlichte mit DUX Mitte 2009 einen erfolgreichen Dreamcast-Titel. Ebenfalls 2009 brachte der GOAT Store mit Irides: Master of Blocks noch einen weiteren Dreamcast-Titel. 2010 erschien mit Fast Striker, entwickelt und vertrieben vom NG:DEV.TEAM, ebenfalls ein Dreamcast-Spiel. Im Jahr 2011 erschien erstmals kein neuer Dreamcast-Titel, doch die Jahre darauf erschienen wieder neue Titel wie Gunlord (2012), Sturmwind (2013) und NEO XYX (2014).
Damit ist die Dreamcast eines der langlebigsten Videospielsysteme. Für den drei Jahre nach der Dreamcast veröffentlichten GameCube erschien das letzte Spiel bereits 2007, für die Xbox, etwa zeitgleich mit dem GameCube veröffentlicht, wurde das letzte Spiel 2008 auf den Markt gebracht. Die Dreamcast hingegen wird bis heute mit neuen Titeln versorgt.
Auch hardwareseitig wird weiter entwickelt. Neben modernen Netzgeräten, die deutlich weniger Wärme produzieren als das Originalgerät und den Betrieb der Dreamcast mit 12 Volt ermöglichen, existiert mit DCHDMI beispielsweise auch eine Platine, nach deren Einbau die Konsole unmittelbar ein HDMI-Signal ausgibt. Durch andere Umbauten (DreamPort) wird die Spielsteuerung mittels Bluetooth-Controllern (DreamConn+) möglich.
Die Dreamcast-Szene war immer wieder Gegenstand von Berichterstattungen in Fachmagazinen, beispielsweise widmete die deutsche und britische Ausgabe der Zeitung gamesTM im Jahr 2009 der Hobbyentwicklerszene auf der Dreamcast ein mehrseitiges Special.[26] Auch das ehemalige, offizielle Dreamcast-Magazin, Dreamcast Kult, berichtete vereinzelt über Homebrew-Projekte.
Technik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Betriebssystem
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Dreamcast-Konsolensystem (zum Starten von CDs, Ändern von Einstellungen etc.)
- SEGA Katana
- KallistiOS
- Windows-CE für Dreamcast
- weniger bekannte von Fans erstellte Systeme, wie etwa libdream, libronin und andere
Dazu ist anzumerken, dass jedes Spiel sein Betriebssystem von der GD-ROM lädt. Als unterste Instanz ist dabei das Sega Operating System immer aktiv.
CPU
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 32-Bit-SH-4-RISC-CPU (128-Bit FPU), 200 MHz (laut SEGA vergleichbar mit einem 1-GHz-Pentium-III in spieletypischen Anwendungen)
- 360 MIPS / 1.4 GFLOPS
- zweifach Superscaler-Processing-Einheit
- 800 MByte/sec Datendurchsatz
- Hauptspeicher: 16 MB SD-RAM
GPU
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Grafikchip: NEC PowerVR Series2 (PVR2DC)
- 100 MHz, 100 Megapixel pro Sekunde (jedoch liegt die Rechenleistung im Vergleich mit anderen GPUs bei 250 Megapixel/sec, da die Dreamcast-GPU die Grafiken durch Tile-Based Rendering anders berechnet)
- Polygone: 5–7 Millionen polys/sec mit Texturen und Effekten (real-world)
- Grafikspeicher: 8 MByte (durch eine spezielle Vierfachkompression belegten Texturen nur 1⁄4 des üblichen Speichers)
- Auflösung: 640×480, technisch 1600×1200
- gleichzeitig darstellbare Farben: 16,7 Millionen (24 Bit / „True Color“)
Soundchip
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Yamaha AICA-Soundchip, 45 MHz, 64 Stimmen gleichzeitig (Digital Sound Processor auf Basis des ARM7)
- 64 Kanäle
- Soundspeicher: 2 MB
Optisches Laufwerk
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- GD-ROM-Laufwerk, Speicherkapazität 1,2 GB, 12X-Geschwindigkeit (Yamaha, Samsung)
Zubehör
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Im Laufe der Lebenszeit der Dreamcast erschien viel Zubehör. Jedes Spiel verfügt auf der Packungsrückseite über Symbole, die anzeigen, welches Zubehör offiziell unterstützt wird. Einige Spiele unterstützen jedoch auch noch anderes Zubehör. Eine Übersicht von für die Dreamcast erschienenem Zubehör:
Erschienenes Zubehör
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Controller verschiedener Hersteller:
- VMU-Speicherkarten
- Vibration Pack (auch als Jump-Pack bzw. in Japan als PuruPuru-Pack bekannt)
- Tastatur und Maus (zur Bedienung der Webbrowser und einiger Spiele)
- Race Controller
- Fishing Controller (bewegungsempfindlicher Controller, konnte neben einem Fisch-Spiel auch z. B. für Virtua Tennis und Soul Calibur verwendet werden, ähnlich der Wiimote)
- Dreamcast Mikrofon (Voice Chat über den Browser, einige wenige Spiele)
- Dreameye (Digitalkamera und Webcam, zum Fotografieren und für Videochat, nur Japan)
- VGA-Box (zum Anschließen an einen PC-Monitor oder kompatible Fernsehgeräte)
- Arcade-Stick
- Broadband/LAN Adapter (verschiedene Ausführungen)
- Lightgun (nur für 50- bzw. 60-Hz-Röhrenfernseher und PC-Röhrenmonitore über VGA-Box)
- Twin-Stick (sehr robuster und schwerer Arcadestick mit zwei Joysticks, nur Japan)
- SEGA Arcade Stick
- Maracas und Tanzmatte (für das Tanzspiel Samba de Amigo)
- Dreamkara (nur Japan, Karaoke-Add-on)
- MadCatz Panther (Flight bzw. Mission Stick)
Nie erschienenes Zubehör (aber als Prototypen existent)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Zip-Drive (zum Speichern von Daten auf Zip-Medien, sollte 2001 erscheinen)
- Swatch Interface (an speziellen Dreamcast Hotspots sollte man sich Daten aus dem Internet laden können)
- Handyadapter (mit der Dreamcast online ohne Telefonanschluss)
- 128 MB VMU-MP3-Player (sollte in den USA im September 2000 für unter 100 USD auf den Markt kommen)
- ISDN-Adapter
- DVD-Laufwerk
- Motion Controller ähnlich der Wiimote,[27] die Technik wurde in den Samba de Amigo-Maracas weiterverwendet
Konkurrenz
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]In der kommerziell erfolgreichen Zeit (1999 bis 2001) konkurrierte die Dreamcast vor allem in Japan mit der PlayStation, in Europa und den USA zudem noch mit dem Nintendo 64. Es gab seinerzeit eine umfangreiche Berichterstattung über die damals noch nicht erschienene PlayStation 2 in den Medien. Letztlich erreichte die Dreamcast keine breite Käuferschicht. Die Vorteile der PlayStation 2, der eingebaute DVD-Player und die Abwärtskompatibilität zur PlayStation, sowie die enormen Werbekampagnen seitens Sony, mit denen Sega als reiner Videospielkonzern nicht mithalten konnte, werden als weitere Gründe vermutet. Die Vorteile der Dreamcast – zukunftsweisende Onlinetechnik, Online-Konsolenspiele, Kantenglättung, PAL-60-Hz-Modus, LCD-VMU – wurden dagegen nach Ansicht von Beobachtern nicht genug beworben.
Besondere Merkmale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]AV-Ausgabe
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Dreamcast beherrscht die „50-/60-Hz“-Bildschirmwiedergabe für europäische Spiele. So können auch einige PAL-Fernsehgeräte Spiele in 60 statt nur 50 Hz wiedergeben. Dies bedeutet eine schnellere Spielgeschwindigkeit und bessere Bildqualität. Diese Funktion findet man ebenfalls bei den nachfolgenden Konsolen GameCube, PlayStation 2 und Xbox. Es gibt auch einen VGA-Adapter, mit dem die Dreamcast in der Auflösung 640×480 an einen PC-Monitor angeschlossen werden kann, allerdings unterstützen dies nicht alle Spiele.
Controller und VMU
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Visual Memory Unit, kurz VMU, ist eine speziell für die Dreamcast entwickelte Speicherkarte. Diese wird nicht, wie sonst üblich, in die Konsole gesteckt, sondern in den Spiele-Controller. Die VMU hat zudem ein kleines Monochrom-Display, ein kleines Steuerkreuz und zwei Aktionsknöpfe. Dadurch ist es möglich, kleine Spiele – ähnlich wie Tamagotchi oder der PokéWalker – auf der Speicherkarte zu laden und zu spielen. Man kann dadurch auch die Uhrzeit und das Datum abrufen und Spielstände verwalten (kopieren und löschen). Dafür sind zwei handelsübliche Knopfzellen nötig. Die VMU kann somit in der Hosentasche überall mit hingenommen werden. Man kann auch zwei VMUs an deren Schnittstelle zusammenstecken. So erlauben es einige Minispiele, Daten auszutauschen oder seine Tamagotchi-ähnlichen Figuren gegeneinander antreten zu lassen, und es können Spielstände übertragen werden.
Ist die VMU im Spiele-Controller eingesteckt, so zeigt das Display durch ein Sichtfenster im Controller aktuelle Spieleinformationen an. Das kann zum Beispiel ein Bild der aktuellen Spielfigur, eine auszuführende Tastenkombination oder wichtige Daten zum Spiel wie die Karten des jeweiligen Spielers sein. Dieses Konzept findet sich in dieser Form bei keiner weiteren Konsole auf dem Markt. Allenfalls der Nintendo GameCube geht eine ähnliche Symbiose mit dem Game Boy Advance ein. Der Game Boy kann bei einigen Spielen dabei beispielsweise als zusätzlicher Controller benutzt werden oder es können zusätzliche Inhalte auf den Game Boy heruntergeladen werden.
Der Spiele-Controller bietet Platz für zwei VMUs oder eine VMU (vorne) plus Vibrationsmodul (dahinter) oder eine VMU (vorne) plus Mikrofon (hinten). Dies hat allerdings den Nachteil, dass der Controller etwas schwerer wird und die Hände dadurch schneller ermüden.
Online-Funktionen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Als erste Spielkonsole überhaupt besitzt die Dreamcast ein ab Werk eingebautes Modem (in den USA 56 kbit/s, ansonsten 33 kbit/s), das man leicht abnehmen kann, um es zum Beispiel bei einem Defekt auszutauschen oder durch den separat erhältlichen Breitbandadapter zu ersetzen. Der Breitbandadapter, von dem nur geringe Stückzahlen produziert worden sind, erlaubt es, in DSL-Geschwindigkeit zu spielen. Lange vor Xbox Live und dem PlayStation Network bot die Dreamcast mit der Dreamarena und dem SEGANet einen Onlinedienst für Spielkonsolen an.
Insgesamt erschienen 26 Titel, die mit der Dreamcast online gespielt werden konnten.[28] Acht Titel sind heute noch online spielbar, teilweise aber nur noch durch von Fans bereitgestellte, private Server. Bei den noch online-spielbaren Titeln handelt es sich um Quake III Arena, Starlancer, Toy Racer, Phantasy Star Online Ver. 1 & 2 (nur noch über private Server), 4x4 Evolution, Maximum Pool (nur noch über private Server) und SEGA Swirl.
Einige Spiele unterstützten zudem das Herunterladen zusätzlicher Inhalte auf VMU, auch Spielstände konnten ins Internet gestellt, sowie wieder heruntergeladen werden.
Die unterschiedlichen Dreamcast-Webbrowser sind zwar auch komplett per Controller bedienbar, zur komfortableren Benutzung stehen jedoch Tastatur und Maus zur Verfügung. In Nordamerika und Japan wurden unterschiedliche mitgeliefert, PlanetWeb (Amerika) und DreamPassport (Japan/Asien). Der europäische Browser DreamKey war eine an Europa angepasste Version des DreamPassport. Jedem Dreamcast-Gerät lag eine GD-Rom mit einem Browser bei. Die Dreamcast-Browser erhielten mehrfach Updates. Die letzte Version, DreamKey 3.0, konnte ab Anfang 2002 kostenlos von Sega bezogen werden.
Spiele
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Insgesamt wurden für die PAL-Regionen 216 Spiele von Sega und später Bigben Interactive für die Dreamcast-Konsole veröffentlicht.
Viele Dreamcast-Titel stellten Neuerungen in der Videospiel-Geschichte dar. Phantasy Star Online war das erste Online-Rollenspiel auf einer Spielkonsole überhaupt und wird noch heute von einer großen Fangemeinde unterstützt, Soul Calibur bewegte sich auf einem grafischen Niveau, das für lange Zeit in der sechsten Konsolengeneration als Referenz galt. Das Spiel Shenmue stellte einen großen Fortschritt in den Kategorien Realismus und Spielweltengröße dar und die Grafik war für diese Zeit herausragend gut. Viele Titel, die zuerst auf der Dreamcast erschienen, wurden später auch für die Xbox, den Nintendo GameCube und die PlayStation 2 umgesetzt und wurden dort teilweise – aufgrund der breiten Käuferschicht – besser verkauft als auf der Dreamcast. Ein Beispiel hierfür war Phantasy Star Online, das auf dem Gamecube und später auf der Xbox (trotz der bei Release bereits leicht veralteten Grafik) einen viel größeren Absatz erzielte, als seinerzeit auf der Dreamcast.
Auch auf den Spielekonsolen der siebten Generation wurden einige Dreamcast-Spiele verfügbar gemacht. Aktuell sind einige Dreamcast-Spiele von Drittherstellern bereits auf Xbox Live Arcade oder dem PlayStation Network erhältlich. Auch SEGA selbst hat im Juni 2010 angekündigt, einen Großteil des eigenen Dreamcast-Portfolios auf Xbox Live Arcade und dem PlayStation Network verfügbar zu machen.[29] Außerdem begann Valve 2011 über seine Spieleplattform Steam auch damit, ehemalige Dreamcast Spiele für den PC zu vertreiben. Anfang 2011 veröffentlichte SEGA die Dreamcast Collection für Xbox 360 und PC, einer Spielesammlung, auf der Sonic Adventure, Crazy Taxi, Space Channel 5: Part 2 und SEGA Bass Fishing enthalten sind.
Bekannte Spiele
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Siehe auch: Kategorie:Dreamcast-Spiel
.mw-parser-output .column-multiple,.mw-parser-output div[style*=column]{margin-top:0.3em}.mw-parser-output .column-multiple>ol,.mw-parser-output .column-multiple>ul,.mw-parser-output .column-multiple>p,.mw-parser-output div[style*=column]>ol,.mw-parser-output div[style*=column]>ul{margin-top:0}.mw-parser-output .column-multiple li,.mw-parser-output div[style*=column] li,.mw-parser-output .column-multiple-avoid{break-inside:avoid;break-inside:avoid-column;page-break-inside:avoid}.mw-parser-output .column-multiple-avoid-3{orphans:3;widows:3}.mw-parser-output .column-multiple .mw-heading{column-span:all}- Tokio Highway Challenge 1 und 2
- Resident Evil Code: Veronica
- Daytona USA 2001
- Space Channel 5
- Virtua Tennis und Virtua Tennis 2
- Toy Commander
- Fighting Vipers 2
- Dead or Alive 2
- Chu Chu Rocket
- Metropolis Street Racer
- Skies of Arcadia
- Grandia II
- Virtua Fighter 3 tb
- F355 Challenge
- Jet Set Radio
- Headhunter
- Confidential Mission
- Eighteen Wheeler – American pro Trucker
- Evolution 1 & 2
- Tomb Raider – Die Chronik
- Unreal Tournament
- Outtrigger
- Quake III Arena
- Power Stone 1 & 2
- Rayman 2: The Great Escape
- Sega GT
- The House of the Dead 2
- Crazy Taxi und Crazy Taxi 2
- Sega Rally Championship 2
- Ecco the Dolphin
- Sega Bass Fishing
- Phantasy Star Online 1 & 2
- Sonic Adventure und Sonic Adventure 2
- Soul Calibur
- Shenmue und Shenmue II
- Star Wars Jedi Power Battle
- Dino Crisis
- Star Wars Demolition
- Ooga Booga
- Bangai-O
Besondere Spiele
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Folgende Spiele genießen bei eingefleischten Dreamcast-Fans einen besonderen Status, da sie recht spät und teilweise gerade wegen der Fans veröffentlicht wurden. So wurden auf Druck der Fans hin, welche in Form von Unterschriftensammlungen und Petitionen ihren Wunsch nach der jeweiligen Dreamcast-Umsetzung äußerten, selbst nach dem Einstellen der Dreamcast-Produktion im 1. Quartal 2001 weiterhin Spiele für Dreamcast veröffentlicht und verkauft.
- Border Down (2003 Japan)
- Densha de Go! 2 – Kōsoku-hen 3000-bandai (1999 Japan)
- Feet of Fury (2003 Nordamerika)
- Ikaruga (2003 Japan)
- Inhabitants (2005 Nordamerika)
- Maqiupai (2005 Nordamerika)
- Para Para Paradise (2001 China, inoffizielle Veröffentlichung)
- Psyvariar 2 (2004 Japan)
- Puyo Puyo Fever (2004 Japan)
- Rez (2001 Japan und Europa)
- Samba de Amigo (2000 Japan, Nordamerika und Europa)
- Seaman
- Shikigami no Shiro II (2004 Japan)
- Trizeal (2005 Japan)
- Radilgy / Radirgy / Rajirugi (2006 Japan)
- Under Defeat (2006 Japan)
- Last Hope (2007 Europa / Nordamerika / Hong Kong / Japan)
- Trigger Heart Exelica (2007 Japan)
- Karous (2007 Japan)
- Wind and Water: Puzzle Battles (Q3 2008 Europa / Nordamerika / Hong Kong / Japan)
- DUX (Q2 2009 weltweit)
- Last Hope: Pink Bullets (Q2 2009 weltweit)
- Rush Rush Rally Racing (2009 Europa / weltweit)
- Fast Striker (2010 Europa / weltweit)
- GunLord (2012 Europa / weltweit)
- Sturmwind (2012 Europa / weltweit)
Offiziell unveröffentlichte Spiele
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Kurz nachdem bekanntgegeben worden war, dass Half-Life nicht mehr für die Dreamcast erscheinen werde, gelangte ein Image von Half-Life (inkl. dem Add-On Blue Shift) ins Netz und wurde sogar bei eBay zum Verkauf angeboten, welches ganz normal auf eine CD-R gebrannt und mit jeder Dreamcast abgespielt werden konnte. Diese Version war etwa zu 95 Prozent fertig und sehr gut spielbar, spiegelte aber keinesfalls die Leistung eines fertigen Produktes wider. Wie und warum diese Version ihren Weg ins Netz und diverse Tauschbörsen fand, wurde nie geklärt. Wahrscheinlich kam das Image von einer beschriebenen GD-Rom. Blue Shift wurde anfangs exklusiv für die Dreamcast entwickelt, später aber als Zusatz für die PC-Version von Half-Life herausgebracht.
- Propeller Arena erlitt ein ähnliches Schicksal wie Half-Life. Hier wurde einfach eine originale SEGA GD-R in eine Datei umgewandelt („rip“).
- Auch von PBA Tour Bowling 2001 tauchte eine spielbare Gold-Version im Peer-to-Peer-Netzwerk auf. Da sich die Dreamcast-Version von PBA 2001 mit derselben Website wie die PC-Version verband, konnte man bis Anfang 2005 damit noch online spielen.
- Von Flintstones: Viva Rock Vegas wurden europäische (PAL) Promotional Copys (White Label) gepresst.
- The House of The Dead 3 sollte grafisch mit der Cel-Shading-Technik realisiert werden. Von diesem Projekt erschienen lediglich zwei Screenshots.
- Auch das Spiel DeeDee Planet hat es nicht mehr in den Handel geschafft.
- GunValkyrie (Trailer)
- Geist Force (Trailer)
- Dark Angel: Vampire Apocalypse (Trailer)
- Propeller Arena (Trailer)
- Innocent Tears (Trailer)
- Arcatera: The Dark Brotherhood (Trailer)
- Black & White (Trailer)
- Giants: Citizen Kabuto
- Heavy Metal: F.A.K.K.²
- Sim City 3000
- System Shock 2
- Turok 2: Seeds of Evil
- Unreal
Spiele, von denen GD-Roms (spielbare Versionen) existieren:
- Castlevania: Resurrection (Trailer)
- Colin McRae Rally 2.0 (30 % fertiggestellt, spielbar)[30]
- Deer Avanger
- Ecco the Dolphin 2 (Trailer)
- Half-Life inkl. Blue Shift (Trailer)
- Heroes of Might & Magic III (Trailer)
- PBA Tour Bowling 2001 (Trailer)
- Propeller Arena
- Take the Bullet
- Test Drive Cycles (Trailer)
- Worms Pinball
- Geist Force (spielbare Beta vom 23. April 1999)
- Hellgate (spielbare Beta)
Dreamcast-Emulation
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Versuche, die Dreamcast-Hardware auf PCs zu emulieren, gab es bereits im Jahr 2000.[31] Die ersten Dreamcast-Emulatoren wiesen jedoch eine äußerst geringe Kompatibilität auf. Der Durchbruch in der Dreamcast-Emulation gelang erst im Jahr 2004, als ein spanischer Programmierer den Emulator Chankast veröffentlichte. Chankast war bereits in der ersten Version mit einer Vielzahl an bekannten Dreamcast-Spielen kompatibel und erregte in einschlägigen Internet-Foren enormes Aufsehen. Zwar wurde die Entwicklung von Chankast in der Folgezeit nicht mehr fortgesetzt, jedoch wurde daraufhin mit der Entwicklung einer Vielzahl an Alternativen begonnen. Besonders hervorzuheben sind hier Demul und nullDC, die heute die Kompatibilität von Chankast noch übertreffen.
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- SEGA-DC.DE – größte deutsche Dreamcast-Webseite
- Dreamcast-Scene.com (mehrsprachig)
- DCEmulation – älteste Dreamcast-Webseite (englisch)
- Dreamcast @ IGN (englisch)
- .mw-parser-output .webarchiv-memento a{color:inherit}DCHelp.net – Tutorials & Tools (Memento vom 3. September 2011 im Internet Archive) (englisch)
- Unseen64 – Material zu unveröffentlichten DC Spielen (englisch / italienisch)
- Dreamcast: TV-Vorstellungen, Cover-Archiv, Browser und mehr
- Dreamcast Collection Besprechung der Xbox360 Version
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Peter Zackariasson, Timothy L. Wilson: The Video Game Industry: Formation, Present State, and Future. 1. Auflage. Routledge, New York 2012, ISBN 978-0-415-89652-8, S. 158 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche [abgerufen am 20. September 2022]).
- ↑ 3Dfx sues Sega, NEC over contract (Memento vom 11. Juli 2012 im Webarchiv archive.today)
- ↑ Sega of America: 3Dfx, Sega, NEC and VideoLogic Settle 3DfxLawsuit. In: AllBusiness. Dun & Bradstreet, 4. August 1998, archiviert vom .mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a{background-position:center right!important;background-repeat:no-repeat!important}body.skin-minerva .mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a{background-image:url("https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/OOjs_UI_icon_external-link-ltr-progressive.svg")!important;background-size:10px!important;padding-right:13px!important}body.skin-timeless .mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a,body.skin-monobook .mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a{background-image:url("https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/MediaWiki_external_link_icon.svg")!important;padding-right:13px!important}body.skin-vector .mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a{background-image:url("https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Link-external-small-ltr-progressive.svg")!important;background-size:0.857em!important;padding-right:1em!important}Original am 5. Januar 2009; abgerufen am 4. Dezember 2012 (englisch).
- ↑ Jim Davis: Windows CE notably absent from Dreamcast launch. In: CNET. 15. September 1999, abgerufen am 23. April 2011 (englisch).
- ↑ Der deutsche Markt im Überblick. In: Computec Media (Hrsg.): MCV - Markt für Computer & Videospiele - Monatsspiegel. Nov/Dez. 99 KW45 - KW 48, 10. Dezember 1999, S. 5.
- ↑ BBC Online, 24. November 1999: Dreamcast beats Playstation record
- ↑ Manfred Rindl, Bedenklicher Wirbel um die PlayStation 2 (Memento vom 16. Dezember 2009 im Internet Archive) in Chip Online, 22. November 2000
- ↑ PlayStation 2 - Special: Weltdominanz im schwarzen Kasten (Memento vom 4. März 2016 im Internet Archive)
- ↑ Genau betrachtet: Ist die PS2 ihren Preis wert? (Memento vom 17. April 2012 im Internet Archive) in Chip Online, 22. November 2000
- ↑ CNN Online, 19. Oktober 2000: PlayStation2: This sequel could be a blockbuster
- ↑ Japan Weekly Chart – Week Ending 07th May 2000. In: VGChartz.com. Archiviert vom Original am 5. Februar 2013; abgerufen am 23. April 2011 (englisch).
- ↑ SEGA-DC.DE: Utopia BootCD
- ↑ Nico Jurran: Dreamcast für Sega ein finanzieller Albtraum. In: Heise online. 24. November 2000.
- ↑ BBC Online, 31. Januar 2001: Sega scraps the Dreamcast
- ↑ André Kunz in Game Over für Dreamcast, Süddeutsche Zeitung, 25. Januar 2001
- ↑ Sega of Japan Dreamcast Release-Liste (Memento vom 23. Mai 2011 im Internet Archive), abgerufen am 10. April 2024.
- ↑ sega-dc.de – Liste aller Indie-Spiele
- ↑ SCHTHACK PSO-Server: www.schtserv.com
- ↑ Sylverant PSO-Server: sylverant.net
- ↑ Christian Klaß: Dreamcast als MP3-Player. In: golem.de. 30. August 2000, abgerufen am 3. Februar 2024.
- ↑ DivX-Cast (Memento vom 17. November 2016 im Internet Archive)
- ↑ https://www.sega-dc.de/dreamcast/Gleam!
- ↑ SEGA-DC.DE: Alice Dreams
- ↑ Indie Dreams Wiki: DreamCon
- ↑ https://www.sega-dc.de/dreamcast/SD-Karten-Adapter
- ↑ Jan Heinrich, Sönke Siemens: Spiele deinen Traum in gamesTM 10/2009, S. 74–77
- ↑ Dreamcast Prototype Controller
- ↑ Dreamcast Online – Online Game List: North America
- ↑ Brett Molina: Sega bringing Dreamcast library to PS3, Xbox 360. In: USA Today. 10. Juni 2010, archiviert vom Original am 13. Juni 2010; abgerufen am 7. Juli 2010 (englisch).
- ↑ Dreamcast Port von Colin McRae Rally 2.0 aufgetaucht! – neXGam – Forum. In: neXGam – Forum. Abgerufen am 18. Oktober 2015.
- ↑ SEGA-DC.DE: Dreamcast-Emulation auf dem PC
Konsolensysteme: SG-1000 (1982) | Sega Master System (1986) | Sega Mega Drive (1989) | Sega Multi-Mega (1992/93) | Sega Mega-CD (1992/93) | Sega 32X (1994) | Sega Saturn (1994) | Dreamcast (1999) | Sega Mega Drive Mini (2019) | Sega Mega Drive Mini 2 (2022)
Handgeräte: Sega Game Gear (1990) | Sega Mega Jet (1994) | Sega Nomad (1995) | Sega Retro Gen (2009)
Nintendo Game Boy
Der Game Boy (jap. .mw-parser-output .Kana{font-size:120%}ゲームボーイ, Hepburn: Gēmu Bōi) ist eine Handheld-Konsole, die von Gunpei Yokoi entwickelt und von Nintendo ab dem 21. April 1989 in Japan zu einem Preis von 12500 Yen angeboten wurde.[4] In Europa war die Konsole etwa ein Jahr später erhältlich. In Deutschland kostete sie zu diesem Zeitpunkt 169 DM.[5] Der Game Boy ist mit fast 120 Millionen verkauften Exemplaren[1] eine der meistverkauften Spielkonsolen und war lange Zeit die meistverkaufte Handheld-Konsole der Welt. Dieser Verkaufsrekord wurde erst vom Nintendo DS mit seinen rund 150 Millionen abgesetzten Geräten gebrochen.[1]
Zunächst war dem Game Boy das Spiel Tetris beigelegt, das vermutlich durch den Erfolg des Game Boy dann zu einem der meistverkauften Computerspiele der Geschichte wurde.[6]
Geschichte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]1980 wurden die Grundlagen des Game Boys in der ebenfalls von Nintendo vermarkteten „Game-&-Watch“-Reihe geschaffen.[7] 1989 erschien der erste Game Boy auf dem Markt, im Laufe der darauf folgenden Jahre wurden hunderte verschiedene Spiele hergestellt. Beliebte Spiele waren Tetris, die Donkey-Kong-, Zelda-, Pokémon-, Metroid- und Super-Mario-Spiele. 1994 brachte Nintendo den sogenannten Super Game Boy auf den Markt, einen Adapter, der es ermöglicht, Game-Boy-Spiele auch auf der bedeutend leistungsfähigeren Super-Nintendo-Konsole an TV-Geräten in Farbe zu spielen. 1995 sorgte die Kampagne „Play It Loud!“ für den Game Boy für Verwirrung, aber laut Nintendo war „Play It Loud!“ lediglich ein Werbeslogan und hatte nichts mit einer angeblich höheren Lautstärke zu tun. 1996 erschien der Game Boy Pocket, eine nur halb so tiefe und etwas kleinere Version des Game Boy mit einem etwas größeren Schwarz-Weiß-Display (der Ur-Game-Boy verfügte über ein grünliches Display). In Japan erschien 1997 der Game Boy Light, eine modifizierte Variante des Game Boy Pocket mit integrierter Hintergrundbeleuchtung.
1998 wurde der Game Boy durch den Game Boy Color abgelöst, der knapp neun Jahre nach Erscheinen des Atari Lynx erstmals auch bei einem Handheld von Nintendo der Darstellung von Spielen in Farbe ermöglichte. 2001 erschien der Game Boy Advance mit erstmals wieder runderneuerter Hardware und einem weiter verbesserten Farbbildschirm. 2003 wurde die zusammenklappbare Variante des Game Boy Advance, der Game Boy Advance SP mit zusätzlicher Frontbeleuchtung und integriertem Lithium-Ionen-Akku eingeführt. 2004 erschien zunächst nur in Japan und den USA – 2005 auch in Europa – der Nintendo DS. Obwohl das Gerät abwärtskompatibel zu Game-Boy-Advance-Modulen ist, stellt er keinen direkten Game-Boy-Nachfolger mehr dar, sondern sollte gemäß Nintendo parallel zur Game-Boy-Linie existieren. 2005 kam mit dem Game Boy Micro eine sehr kleine Version des Game Boy Advance auf den Markt. Noch im selben Jahr erschien in Nordamerika der Game Boy Advance SP mit einer verbesserten Hintergrundbeleuchtung, welche der Beleuchtung des Game Boy Micro entspricht. 2006 erschien der Nintendo DS Lite, eine etwas kleinere Version des Nintendo DS mit verbessertem Display.
Modelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Game Boy | Game Boy Pocket | Game Boy Color |
| Game Boy Advance | Game Boy Advance SP | Game Boy Micro |
| (ohne Abbildung: Game Boy Special Edition, Game Boy Light) | ||
Game Boy
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Der Urahn der Reihe namens Game Boy (umgangssprachlich auch Game Boy Classic genannt) erschien 1989 und war zu Verkaufsbeginn nur zusammen mit dem Spiel Tetris erhältlich. Vor allem wegen des vergleichsweise schwachen Prozessors und des schon damals veralteten Schwarzweiß-Bildschirms sah er sich anfangs vielen Skeptikern gegenüber. Eine für diese Zeit geringe Größe, geringe Kosten und sparsamer Batterieverbrauch erwiesen sich jedoch als entscheidende Vorteile gegenüber den Konkurrenzkonsolen wie dem Sega Game Gear und dem Atari Lynx. Außerdem konnte man einen wiederaufladbaren Akku erwerben.
Super Game Boy
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Einen Sonderfall stellt der 1994 vorgestellte Super Game Boy dar. Es handelt sich dabei um einen Adapter, mit dem es möglich ist, Game-Boy-Spiele mit Hilfe des Super Nintendo Entertainment System (SNES) auf einem Fernsehgerät zu spielen. Die Game-Boy-Spiele werden allerdings nicht durch die Hardware der SNES-Konsole ausgeführt. Im SNES-Modul ist im Wesentlichen die Hardware eines Game Boys verbaut. Lediglich die Bild- und Tonausgabe werden an die SNES-Konsole durchgereicht. Ausschließlich in Japan erschien ein Nachfolger, der Super Game Boy 2. Dieser bietet neben verbessertem Timing auch eine Schnittstelle für ein Linkkabel zur Unterstützung von Mehrspieler-Spielen.[8]
Game Boy Special Edition
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
1995 wurde der ursprüngliche Game Boy unter der Bezeichnung Special Edition neu aufgelegt. Er war zwar technisch mit dem Game Boy Classic identisch, aber in zunächst sechs unterschiedlichen Gehäusen (Rot, Gelb, Grün, Schwarz, Weiß, transparent), später auch in Blau, erhältlich und wurde mit einer Transportbox ausgeliefert, in die das Gerät und bis zu sechs Spiele in Hüllen passten.
Game Boy Pocket
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Der Game Boy Pocket aus dem Jahr 1996 erfüllt unverändert die Leistungsmerkmale des klassischen Game Boys. Jedoch ist er deutlich kleiner und wird standardmäßig in silbriger Farbe und mit zwei AAA-Batterien angeboten. Das LC-Display ist außerdem kontrastreicher als das Display des bisherigen Game Boys und hat eine silbergraue anstelle der vom Vorgänger bekannten grünen Grundfarbe. Erreicht wurde dies, indem anstelle eines einfachen STN-Displays auf ein FSTN- bzw. TSTN-Display gesetzt wurde. Der Linkkabel-Anschluss wurde verkleinert, um der Größe des neuen Gehäuses Rechnung tragen zu können. Mit einem Linkkabel, dem ein Adapter beilag, war das Spielen zwischen alten Game-Boy-Geräten und dem neueren Game Boy Pocket weiterhin möglich. Die ersten Exemplare des Game Boy Pocket verfügten noch über keine Batteriestandanzeige; diese kam erst später hinzu.
Das Wort „pocket“ (englisch für Tasche) weist auf das kompakte Design hin.
Game Boy Light
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Der Game Boy Light basiert auf dem Game Boy Pocket und wurde 1997 ausschließlich in Japan vertrieben. Er ist etwas größer als der Game Boy Pocket und verfügt über eine zuschaltbare grüne Hintergrundbeleuchtung. Er hat das schärfste Display aller Monochrom-Game-Boy-Geräte. Der Game Boy Light benötigt zum Betrieb zwei AA-Batterien, mit denen er trotz eingeschalteter Hintergrundbeleuchtung eine gleich lange Betriebsdauer wie der Game Boy Pocket erreichen kann. Die Standardversion des Game Boy Light erschien in den Farben Gold und Silber. Später wurde mit der Linie Skeleton noch eine auf 5000 Stück limitierte, transparente Version angeboten. Nach Beginn der sogenannten Pokémon-Euphorie veröffentlichte Nintendo den Game Boy Light auch in einer gelben Pikachu-Sonderedition.
Game Boy Color
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Der Game Boy Color erschien 1998 als indirekter Nachfolger des Game Boy sowie des Game Boy Pocket. Er basiert technisch auf der ersten Game-Boy-Linie (Z80-Generation). Der Game Boy Color verfügte als erste tragbare Nintendo-Spielkonsole einen Farbbildschirm und konnte aus einer Palette von 32.768 Farben in Game-Boy-Color-Spielen 56 gleichzeitig darstellen. Die Vorgänger hatten noch eine Anzeige mit vier Grautönen. Wenn ein Spiel, das für den klassischen Game Boy konzipiert wurde, eingelegt wird, werden bei dessen Abspielen maximal 10 Farben verwendet. Diese Anzahl ergibt sich aus vier Farben für Hintergrundgrafiken und je drei Farben (vier Farben minus eine Farbe für transparent) für die beiden Kategorien von Objekten („Sprites“). Für 93 originale Game-Boy-Spiele hat der Game Boy Color eine separate Palette von 10 Farben eingespeichert, unter anderem für Donkey Kong (1994), Kirby’s Dream Land, Pokémon Rot/Blau, Super Mario Land, Tetris und Wario Land: Super Mario Land 3. Zudem kann der Spieler bei allen Spielen (auch den vorgenannten) eine von zwölf Paletten auswählen, indem er beim Start eine Richtungstaste und ggf. A oder B drückt.[9]
Spiele, die für den Game Boy Color entwickelt wurden, können für Hintergründe und Objekte jeweils acht Paletten mit je vier (Hintergrund) bzw. drei (Objekte) Farben frei definieren, in der Summe also 56 Farben.[10] Für jede 8×8-Pixel-Kachelgrafik („Tile“) kann dann eine der acht für deren Verwendung (Hintergrund oder Objekt) anwendbaren Paletten ausgewählt werden. Einige Spiele nutzen ein der Scanline-Grafik ähnliches Farbschaltverfahren zur Erzeugung von bis zu 2.000 gleichzeitig verfügbaren Farben, indem sie die Hintergrundpaletten jede zweite Zeile wechseln,[11] wie z. B. Alone in the Dark zur Darstellung vorab gerenderter 3D-Hintergründe oder Cannon Fodder für Vollbild-Video.
Die Gehäuseform wurde nur geringfügig verändert und liegt in der Dicke zwischen dem Game Boy und dem Game Boy Pocket. Neu war eine Infrarot-Schnittstelle, mit der man einige Spiele auch ohne Linkkabel gegen andere Spieler spielen kann. Mit dem passenden Modul (z. B. Mission: Impossible) ist es möglich, den Game Boy Color dank der Infrarotschnittstelle in eine Fernbedienung für andere elektronische Geräte zu verwandeln. Oft wurde sie jedoch nur zur Übertragung von kleineren Spieldatenmengen, etwa Highscores, verwendet.
Die Soundfähigkeiten der Konsole blieben weitestgehend unverändert; die beiden Pulswellen-Generatoren wurden gegen zwei Rechtecksignalgeneratoren getauscht. Der Audio Input-Kanal am Modul, welcher dem Spiel ermöglichte, im Spielmodul durch eigene Hardware selbst Sound zu generieren und direkt an die Konsole zur Ausgabe weiterzugeben, wurde gestrichen, da beim Vorgängermodell kein Spiel diese Möglichkeit nutzte. Die Klangcharakteristik des Geräts änderte sich nur geringfügig.
Den Game Boy Color gibt es in den Gehäuse-Designs Blau, Rot, Grün, Gelb, Hellgrün, Türkis, Lila, transparentem Lila, transparentem Weiß sowie in einer limitierten gelben Pokémon-Auflage.
Game Boy Advance
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Der Game Boy Advance, Arbeitstitel „Project Atlantis“, war das erste Modell der Game-Boy-Linie, das nicht auf der Technik des ursprünglichen Game Boy basierte. Als Nachfolger des Game Boy Color besaß diese Konsole eine Breitbildversion seines Farbdisplays sowie einen 32-Bit-ARM-RISC-Prozessor, welcher Skalierung und Rotation seiner vier Hintergrundebenen hardwareseitig unterstützte. Der Game Boy Advance konnte jedoch in drei seiner fünf Grafikmodi erstmals alle unterstützten Farben gleichzeitig darstellen. Wegen seiner Leistungsfähigkeit und der Ähnlichkeit der vom Super Nintendo „portierten“ Spiele, die für das Handheld neu herausgebracht wurden, wurde der Game Boy Advance auch als Super Nintendo Entertainment System im Taschenformat bezeichnet, hat jedoch mit der 16-Bit-Heimkonsole technisch nichts gemeinsam und ist ihr in einigen Punkten sogar überlegen. Grafisch für auf Spritegrafik basierende Konsolen eigentlich anspruchsvolle Spiele wie Doom erschienen für den Game Boy Advance. Mit zwei separat erhältlichen AA-Batterien wird eine Betriebsdauer von etwa 15 Stunden erreicht. Auf den Markt kam der Game Boy Advance in Japan am 21. März 2001, in Nordamerika am 11. Juni und in Europa und Australien am 22. Juni desselben Jahres. In der Volksrepublik China (außer Hongkong) erschien das Gerät wenige Jahre später, und zwar am 8. Juni 2004. Aufgrund des unerwarteten Erfolges des Spiels Pokémon und des wahrscheinlich hohen Einführungspreises der Konsole entschied man sich dafür, mit dem Game Boy Advance zuerst die Farbversion des Game Boy Pocket zu veröffentlichen.
Game Boy Player
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Ähnlich wie der Super Game Boy ist der 2003 erschienene Game Boy Player ein vollständiger Game Boy Advance. Mit ihm ist es möglich, Game-Boy-, Game-Boy-Color- und Game-Boy-Advance-Spiele auf dem GameCube zu spielen.
Game Boy Advance SP
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Mit dem Game Boy Advance SP erfuhr der Game Boy Advance eine sogenannte Komfort-Überarbeitung. Der Game Boy Advance SP ist aufklappbar und verfügt über eine Beleuchtung, die das Spielen auch in der Dunkelheit ermöglicht. Anfangs wurde ein Frontlight (Beleuchtung von vorn) eingesetzt, später gab es in geringerer Stückzahl Geräte, die über eine Hintergrundbeleuchtung verfügten. Anders als der Game Boy Advance verfügt er über einen eingebauten Lithium-Ionen-Akku, der seither Standard in Nintendos Handheld-Konsolen ist. Damit wird ein Betrieb von etwa zehn Stunden ermöglicht. Das Design wurde später bei der Produktion des Nintendo DS übernommen und verbessert.
Trotz grundlegender Änderung der Hardware sind beide Vertreter der Game-Boy-Advance-Generation abwärtskompatibel, sodass alle Game-Boy-Spiele auf ihnen abgespielt werden können. Allerdings wird für Mehrspieler-Spiele zwischen Game-Boy- und Game-Boy-Color-Spielen das bisher bekannte Linkkabel benötigt, da das Game-Boy-Advance-Linkkabel nur mit Game-Boy-Advance-Spielen funktioniert.
Sowohl Game-Boy-Advance- als auch -SP-Modelle wurden in vielen verschiedenen Farben produziert.
Game Boy Micro
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Als neue Version des Game Boy Advance erschien dieser bisher kleinste Game Boy (Maße: 10 cm × 5 cm × 1,8 cm) im Herbst 2005. Die verbaute Hardware ist identisch mit dem Game Boy Advance und dem Game Boy Advance SP. Der Game Boy Micro ist allerdings nur noch mit Game-Boy-Advance-Spielen kompatibel, da die Hardware zum Abspielen der Spiele des Game-Boy-Color nicht mehr verbaut werden konnten und eine Emulation der Software nicht in Frage kam. Er wurde kurz darauf aufgrund niedriger Verkaufszahlen von Nintendo eingestellt. Der Grund dafür dürfte die geringe Größe und die fehlende Abwärtskompatibilität gewesen sein, obwohl er das schärfste Display aller Game Boys aufwies. In Japan wurde der Game Boy Micro zusammen mit Nintendos Multimediaplayer PlayYan als Media Player vermarktet, was aber nicht zu dem erhofften Absatz am Markt führte. Da Aussehen und Größe gut zum modernen Standard passen, ist er heute ein begehrtes Sammlerobjekt und erzielt Preise, die in Höhe des letzten Neuverkaufspreises liegen.
Exklusiv in Japan gab es eine Handvoll Sondereditionen, z. B. die „Final Fantasy IV“-Edition und die Famicom-Edition.
Hardware
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Die technischen Details des klassischen Game Boys
- Hersteller: Nintendo
- Erscheinungsjahr: 1989
- CPU: 8-Bit-CMOS;[12][13] 4,19 MHz Taktfrequenz bzw. 2,097 MHz Zyklusfrequenz
- Speicher: 8 KB RAM; 8 KB Grafikspeicher,[12]
- Sound: 4-Kanal-Stereo-Sound + 1 Input-Kanal + 1 externer Kanal[12]
- Bildschirm: LCD; Größe: 4,7 × 4,3 cm[14]/1,9 × 1,7 Zoll (6,4 cm bzw. 2,6 Zoll Bildschirmdiagonale); Auflösung: 160 × 144 Pixel; 4 Graustufen;[12] Bildfrequenz: ca. 59,7 Hz[15]
- Sprites: 8 × 8 Pixel oder 8 × 16 Pixel groß; Maximalanzahl 40 Stück
- Stromversorgung: 4 Mignon-Batterien, Steckernetzteil 6 V⎓/120 mA[13] (separat erhältlich)
- Abmessungen (H×B×T): 148 mm × 90 mm × 32 mm[13]
- Gewicht: ca. 300 g inkl. Batterien[13]
- Herstellungsland: Japan, später Volksrepublik China
- Die technischen Details des Game Boy Color
- Hersteller: Nintendo
- Erscheinungsjahr: 1998
- CPU: 8 Bit; 4 und 8 MHz Taktfrequenz[12]
- Speicher: 32 KB RAM und 16 KB Bildwiederholspeicher[12]
- Sound: 4-Kanal-FM-Stereo-Sound + 1 externer Kanal[12]
- Bildschirm: LCD; Größe: 4,4 × 4 cm[14] /1,7 × 1,6 Zoll (6 cm bzw. 2,3 Zoll Bildschirmdiagonale); Auflösung: 160 × 144 Pixel;[14] 10, 32 oder 56 Farben aus einer Palette von 32.768 Farben gleichzeitig auf dem Bildschirm darstellbar;[12] Bildfrequenz: ca. 59,7 Hz[15]
- Stromversorgung: 2 Mignon-Batterien; möglich auch mit separatem AC-Adapter
- Abmessungen (H×B×T): 133 mm × 75 mm × 27 mm
- Herstellungsland: Japan, später Volksrepublik China
- Verkaufte Geräte: ca. 49,3 Millionen
- Anzahl verfügbarer Spiele: ca. 1200
Ein unbeleuchteter schwarz-grüner LC-Bildschirm, ein Steuerkreuz, das acht Richtungen unterstützt, und vier Steuertasten, wie beim NES mit „A“, „B“, „SELECT“ und „START“ benannt, sowie ein Mono-Lautsprecher sind die von außen sichtbaren Komponenten. Die Funktion der Steuertasten ist vom Spiel abhängig. „START“ hat in den meisten Fällen eine Pause-Funktion inne, in Menüs wird „A“ generell zum Bestätigen und „B“ zum Abbrechen genutzt.

An der Unterseite befindet sich eine 3,5-mm-Kopfhörerbuchse mit Stereoausgang. Auf der rechten Seite gibt es zusätzlich einen Lautstärkeregler, auf der linken Seite einen für den Kontrast. Der Ein-Aus-Schalter befindet sich oben an der Stirnseite des Geräts direkt neben dem Steckplatz für die ROM-Steckmodule die auch Game Paks genannt werden.
Über einen seitlich angebrachten Anschluss (Game Link Dialogkabel) kann der Game Boy mit einem weiteren Game Boy verbunden werden, was Mehrspieler-Partien zu zweit erlaubt, falls das Spiel dies unterstützt. Durch einen optional erhältlichen 4-Spieler-Adapter kann man den Game Boy auch an bis zu drei weitere Game Boys anschließen. Auf der anderen Seite gibt es einen Stromanschluss, an dem ein Netzteil angeschlossen werden kann. Im Laufe der Zeit erschien zahlreiches Zubehör, wie Lupen für den Bildschirm, Lampen, eine Game Boy Camera oder ein Game Boy Printer.
Module
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Um neue Generationen der Hardware attraktiver zu machen und den Spielern das Spielen ihrer Spiele auf neuerer Hardware zu ermöglichen, war es die Strategie von Nintendo, die Game-Boy-Plattform abwärtskompatibel zu halten. Über den Formfaktor der Spielmodule sollte gewährleistet werden, dass die Module nur mit einer kompatiblen Plattform gespielt werden können.
Schwarze Module, die für den Game Boy Color vermarktet wurden, aber den grauen Standardmodulen glichen, konnten auf älteren Game-Boy-Konsolen mit einer kompatiblen (eingeschränkten) Farbpalette abgespielt werden. Bei einigen Spielen, wie bei Zelda DX, konnten dabei einige Funktionen nicht genutzt oder Level nicht betreten werden.
Durchsichtige Module, die nur für den Game Boy Color gedacht und mit der Aufschrift „Only for Game Boy Color“ versehen waren, konnten auf den älteren Game-Boy-Plattformen nicht gespielt werden, boten dafür aber auch die komplette Farbpalette. Ursprünglich sollte der Formfaktor des Moduls ein Spiel mit der originalen Game-Boy-Plattform verhindern. Allerdings hatten weder Game Boy Pocket noch der Super Game Boy den mit dem Schalter des Geräts verbundenen Haltezapfen, sodass das Modul vom Hersteller trotzdem auf die Ausgabe auf einer inkompatiblen Plattform vorbereitet werden musste: steckt man diese Module z. B. in einen Game Boy Pocket oder Super Game Boy, erscheint eine Fehlermeldung.
Die Module des klassischen Game Boys konnten durch einen eigens dafür vorgesehenen Pin eigenen Sound generieren und zur direkten Ausgabe an die Konsole weitergeben, wenn zusätzliche Chips für das Modul verwendet worden sind. Da kein Entwickler diese Möglichkeit nutzte, wurde der direkte Audiokanal des Moduls im Game Boy Color gestrichen.
Mit der Einführung des Game Boy Advance und der Veränderung (sowie der Verkleinerung) der Konsolenform wurde die Form der Module nochmals verändert. Game-Boy-Advance-Module konnten nun nicht mehr in den Schacht der ursprünglichen Game-Boy-Geräte eingeführt werden; jedoch war der Game Boy Advance durch eine zweite CPU mit allen Game-Boy-Spielen kompatibel und die Game-Boy-Module konnten in den gleichen Schacht eingeführt werden wie die Game-Boy-Advance-Module, wenn sie auch wegen der größeren Form aus der Konsole herausragen mussten.
Herstellung und Vertrieb der Module übernahm Nintendo; hierfür war vom Entwicklerstudio selbst eine Zahlung an Nintendo zu leisten, inklusive der Lizenzgebühren.
Spielstände und modulinterne Extras
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einige Module sind mit einer Batterie versehen, um Spielstände zu speichern oder eine innere Uhr zu betreiben. So lange Nintendo Spielmodule für den Game Boy herstellte, konnte man Spielmodule mit entladener Batterie einsenden, um sie vom Hersteller kostenlos austauschen zu lassen. Der Herstellungspreis für das Modul wurde jedoch durch solche zusätzliche Hardware-Ausstattung in die Höhe getrieben, sodass viele Spiele statt auf batteriegestützte Spielstände auf ein Passwort-System für Spielstände zurückgriffen: um den Spielstand wiederzuerlangen, musste der Spieler das vom Spiel generierte Passwort eingeben. Dabei handelte es sich entweder um ein einfaches Losungssystem, um ein Level freizuschalten, oder um ein Chiffrierverfahren, in dem Informationen des Spielstands, wie erarbeitete Lebenspunkte, Munitionsvorräte oder einige Items, in ein Alphabet übertragen werden. Da das Passwort nicht zu lang werden sollte, war auch der „Speicherplatz“ begrenzt. In Zelda: Oracle of Ages und Zelda: Oracle of Seasons wurde erstmals die Möglichkeit genutzt, einen Spielstand als Code statt über Link-Kabel aus einem Spiel in das andere zu übertragen.
Kopierschutz
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Um das Abspielen nicht von Nintendo lizenzierter Software zu verhindern, besaß der Game Boy einen CPU-internen Bootloader als Schutz. Beim Start eines lizenzierten Spiels wird das Nintendo-Logo eingeblendet. Sobald das Logo die Bildschirmmitte erreicht hat, vergleicht der CPU-interne Bootloader das Logo auf dem Spielmodul mit dem intern abgespeicherten Nintendo-Logo. Da der Schutz auf dem Einsatz des markengeschützten Nintendo-Logos beruht, hätte dessen Verwendung für ein nicht-lizenziertes Produkt dem Konsolenhersteller die Möglichkeit gegeben, den entsprechenden Anbieter wegen des nicht genehmigten Gebrauchs des Logos zu verklagen. Dem britischen Entwickler Argonaut Software gelang es, den Logo-Schutz auszuhebeln, da der Bootloader das Logo vor dem Vergleich erneut vom Spielmodul gelesen hat (ein sog. TOCTOU-Angriff). Argonaut und Nintendo gingen eine Geschäftsbeziehung ein, die zur Entwicklung des 3D-Zusatzchips Super FX für das Super Nintendo Entertainment System führte.[16]
Software und andere Einsatzzwecke
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Grundsätzlich ist der Game Boy für Spiele konzipiert, aber es ist auch möglich, mit speziellen Programmen wie Carillon, LSDj, Music Box, Nanoloop,[17] Pocket Music etc. (Chiptune-)Musik zu komponieren. Einige Musiker verwenden den Game Boy auf ihren Konzerten.[18]
In Japan brachte Nintendo mit dem PlayYan[19] ein Modul für den Game Boy Advance auf den Markt, mit welchem Dateien im MP3-, MPEG-4- und DivX-Format dargestellt und abgespielt werden können. Eigene Musik lässt sich mit ihm jedoch nicht komponieren. Der PlayYan wurde, ohne die Videofunktion, auch außerhalb Japans als Game Boy MP3 Player verkauft.
Außerdem kann der Game Boy auch für einfache Mess- und Steueraufgaben benutzt werden. Hierzu müssen besondere Steckmodule gebaut und eigene Programme geschrieben werden. Es werden auch einige Spezialmodule u. a. fürs Autotuning, zum Blutzuckermessen[20] oder zum Steuern von Nähmaschinen kommerziell vertrieben.
Emulation
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Für die Emulation des Game Boy auf PCs, mobilen Endgeräten und anderen Spielkonsolen wurden Programme wie beispielsweise VisualBoyAdvance entwickelt. Der legale Einsatzzweck dieser Programme ist das Ausführen von Homebrew-Spielen, die von ihren Entwicklern teils kostenlos und teils kostenpflichtig auf Plattformen wie itch.io zum Download angeboten werden. Zudem bieten sie oft Funktionen zur Fehlersuche für Homebrew-Entwickler. Die Emulatoren werden jedoch auch dafür genutzt, ROM-Abbilder von urheberrechtlich geschützten Spielen, die über Websites und Tauschbörsen illegal verbreitet werden, auszuführen.[21]
Nach der Game-Boy-Serie
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der Nintendo DS (Dual Screen oder Developer System) wurde ursprünglich parallel zum Game Boy Advance vermarktet, aber fortan von den Entwicklern dem Game Boy Advance vorgezogen. Der DS verfügt als Neuerungen über einen Touchscreen, ein eingebautes Mikrofon und einen WLAN-Adapter z. B. für Online-Mehrspielerpartien. Diese Plattform ist nur zu Game-Boy-Advance-Spielen, nicht aber zu Game-Boy-Color-Spielen, abwärtskompatibel. Nach Angaben von Nintendo ist der Nintendo DS allerdings nicht das Nachfolgemodell des Game Boy Advance, sondern vielmehr ein neuer Spiele-Handheld. Er gehört somit nicht zur Game-Boy-Reihe.
Nachleben des Game Boys
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der Game Boy gehört zu den ikonischen Sinnbildern der Popkultur der 90er Jahre.[22][23][24] Daher ist er im Trend des Retrogaming und Retrocomputing, aber auch bei Bastlern und Künstlern nach wie vor beliebt. Die Herstellung kompatibler Module ist durch die weitestgehend offen gelegte Verschaltung und Hardware auch für Heimanwender und Bastler möglich; auf die Herstellung von, auch mit Chips und anderen Elementen bereits bestückten, PCB Boards und Cases sind mittlerweile mehrere Firmen spezialisiert. Auch Module, die als Adapter für modernere Medien wie SD-Karten fungieren, werden mit Ladeprogrammen vertrieben, sodass der Einsatz von eigener Software und eigenen Spielen auf Originalhardware möglich ist. Auch lange nach der Einstellung der Game-Boy-Serie durch Nintendo erscheinen deshalb immer noch Game-Boy-Spiele von unabhängigen Spieleentwicklern im Internet.
Mittlerweile werden auch von Drittherstellern Game-Boy-kompatible Handheld-Konsolen als System on a chip-Design mit FPGA-Chips und moderner Hardwareausstattung wie beleuchteten Displays, integriertem Speicher und Batterien oder zusätzlichen Schnittstellen wie USB in limitierter Stückzahl vertrieben. Diese Konsolen sind durch originäres, aber eben kompatibles Hardware-Design vollständig legal. Ein Beispiel dafür ist der Analogue Pocket, der seit 2019 vom Retro-Konsolen-Hersteller Analogue gebaut und vertrieben wird.
Für die Nintendo Switch veröffentlichte Nintendo, mehr als 30 Jahre nach Erscheinen des Game Boys, den Emulator „Game Boy – Nintendo Switch Online“ (zum Release der Switch 2 in „Game Boy – Nintendo Classics“ unbenannt) mit zunächst 16 Original-Spielen, die im Rahmen der kostenpflichtigen Nintendo-Switch-Online-Mitgliedschaft heruntergeladen und gespielt werden können.
Literatur
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- David Sheff: Nintendo – Game Boy; Goldmann, M., 1993, ISBN 3-442-30600-0.
- Michael S. Mühlhaus: Messen und Steuern mit dem Game Boy, Franzis, 2003, ISBN 3-7723-4205-1.
- Seppatoni: Game Boy Games Guide; lulu.de, 2007.
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Offizielle Websites: Game Boy; Game Boy Pocket; Game Boy Color
- Technische Daten der Game-Boy-Modelle auf www.nintendo.de
- Game Boy Land – deutschsprachige Website über den klassischen Game Boy
- neXGam – viele Specials & Testberichte zum Game Boy
- neXGam – viele Specials & Testberichte zum Game Boy Color
- PlanetGameboy.de – deutsches Onlinemagazin zum Game Boy Advance
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ a b c IR Information: Sales Data - Dedicated Video Game Sales Units. In: Nintendo Co., Ltd. Abgerufen am 24. Oktober 2022 (englisch).
- ↑ Die 10 erfolgreichsten Game-Boy-Spiele aller Zeiten. 23. April 2019, archiviert vom .mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a{background-position:center right!important;background-repeat:no-repeat!important}body.skin-minerva .mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a{background-image:url("https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/OOjs_UI_icon_external-link-ltr-progressive.svg")!important;background-size:10px!important;padding-right:13px!important}body.skin-timeless .mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a,body.skin-monobook .mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a{background-image:url("https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/MediaWiki_external_link_icon.svg")!important;padding-right:13px!important}body.skin-vector .mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a{background-image:url("https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Link-external-small-ltr-progressive.svg")!important;background-size:0.857em!important;padding-right:1em!important}Original (nicht mehr online verfügbar) am 1. Mai 2019; abgerufen am 6. August 2020.
- ↑ Dedicated Video Game Sales Units. Nintendo, 30. Juni 2022, abgerufen am 30. August 2022 (englisch).
- ↑ Happy 30th B-Day, Game Boy: Here are six reasons why you’re #1. In: Ars Technica. 21. April 2019, abgerufen am 30. August 2020 (amerikanisches Englisch).
- ↑ Stephan Freundorfer: 25 Jahre Game Boy in Deutschland. In: Der Spiegel. 12. Oktober 2015, abgerufen am 30. August 2020.
- ↑ Damien McFerran: The Making of Gameboy. In: Retro Gamer. S. 42–47 (englisch).
- ↑ Feature: The Making of the Nintendo Game Boy – Damien McFerran (englisch)
- ↑ Brian C. Byrne, Console Gamer Magazine: History of the Super Nintendo (SNES): Ultimate Guide to the SNES Games & Hardware. Console Gamer Magazine, S. 7 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
- ↑ Notes:Game Boy Color Bootstrap ROM. In: The Cutting Room Floor. Abgerufen am 6. Juli 2024.
- ↑ Palettes. In: Pan Docs. Abgerufen am 6. Juli 2024.
- ↑ GBC Hicolour notes. Abgerufen am 6. Juli 2024.
- ↑ a b c d e f g h Stephan Freundorfer: Special: Rückblick: Nintendo Game Boy. In: gamepro.de. IDG, 19. Januar 2014, abgerufen am 28. April 2014.
- ↑ a b c d Evan Amos: Game Boy Manual. Nintendo of America, abgerufen am 30. April 2014 (englisch).
- ↑ a b c Technische Daten. Abgerufen am 29. Februar 2020 (deutsch).
- ↑ a b TASVideos/Platform Framerates. Abgerufen am 29. Februar 2020.
- ↑ Damien McFerran: Born slippy: the making of Star Fox. 22. Juni 2014, abgerufen am 19. August 2019.
- ↑ Nanoloop. Abgerufen am 11. März 2015.
- ↑ YouTube - Gameboy. Abgerufen am 11. März 2015.
- ↑ IGN - PlayYan. IGN, abgerufen am 11. März 2015 (englisch).
- ↑ diabetsinfo.de. Abgerufen am 11. März 2015.
- ↑ Intellectual Property & Piracy FAQ. In: en-americas-support.nintendo.com. Nintendo, abgerufen am 15. Oktober 2024 (englisch).
- ↑ The Interesting History of the Game Boy and Its Impact on Pop Culture | Mr. Pop Culture. 31. Mai 2022, abgerufen am 26. August 2023 (amerikanisches Englisch).
- ↑ Daniela Hernandez: Tech Time Warp of the Week: Celebrate 25 Years of Game Boy With This Righteous Ad. In: Wired. ISSN 1059-1028 (wired.com [abgerufen am 26. August 2023]).
- ↑ Smithsonian Magazine: Thirty Years Ago, Game Boy Changed the Way America Played Video Games. Abgerufen am 26. August 2023 (englisch).
| Stationäre Spielkonsolen |
Color TV-Game (6 • 15 • Racing 112 • Block Breaker • Computer TV-Game) • Nintendo Entertainment System (Famicom) • Super Nintendo Entertainment System • Virtual Boy • Nintendo 64 (iQue Player) • Nintendo GameCube (Panasonic Q) • Wii (Wii mini) • Wii U • NES Classic Mini • Nintendo Switch • SNES Classic Mini • Nintendo Switch 2 |
|
| Tragbare Spielkonsolen |
Game & Watch • Game Boy • Game Boy Color • Game Boy Advance (SP • Micro) • Pokémon Mini • Nintendo DS (Lite • DSi) • Nintendo 3DS (2DS • New 3DS • New 2DS XL) • Nintendo Switch (Lite) • Nintendo Switch 2 | |
| Arcade-Automaten |
Nintendo Game Boy Advance
Der Game Boy Advance (kurz GBA) ist eine Handheld-Konsole und der Nachfolger des Game Boy bzw. des Game Boy Color. Es ist Nintendos erster Handheld, der nicht auf der Technik des ursprünglichen Game Boy basiert (mit Ausnahme der Game-&-Watch-Serie). Der Game Boy Advance hat mit dem Game Boy Advance SP eine Überarbeitung erfahren. Trotz der grundlegenden Änderung der Hardware können die beiden ersten Vertreter der Advance-Generation alle Game-Boy-Spiele verarbeiten. Alle Game-Boy-Advance-Modelle erschienen in verschiedenen Farben.
Der Game Boy Advance verkaufte sich in seiner gesamten Lebensspanne etwa 81,51 Millionen Mal[1] und ist damit eine der meistverkauften Handheld-Konsolen.
Überblick
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der Game Boy Advance (Arbeitstitel: „Advanced Game Boy“[4]) wurde von Nintendo 2001 als Nachfolger des sehr erfolgreichen Game Boy Color auf den europäischen Markt gebracht.[5]
Gegenüber dem klassischen Game Boy bietet die Handheld-Konsole deutlich gesteigerte Rechen- und Grafikleistung, einen größeren Bildschirm mit breiterem Seitenverhältnis, eine veränderte Form (Quer- statt Hochformat) und volle Abwärtskompatibilität zu Game-Boy- und Game-Boy-Color-Spielen. Beim Spielen von Game-Boy- und Game-Boy-Color-Spielen auf einem Game Boy Advance konnte mit den L- und R-Tasten das Seitenverhältnis des dargestellten Bildes geändert werden (Original-Seitenverhältnis oder langgestrecktes Vollbild).
Auf Kritikpunkte, wie die für größere Hände unergonomischen Tasten, die fehlende Entspiegelung und die fehlende Hintergrundbeleuchtung, reagierte Nintendo mit der Entwicklung des stark verbesserten Game Boy Advance SP.
Technische Daten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Bildschirm: Größe: 6,12 cm breit × 4,08 cm hoch; Auflösung: 240 × 160 Pixel; Typ: TFT-Bildschirm mit 32.768 darstellbaren Farben; Bildfrequenz: ca. 59,7 Hz[6]
- CPU: 16,77-MHz-32 Bit-RISC-CPU (ARM7TDMI, ARM-Architektur) und 8 Bit CISC-CPU (Z80/8080-Derivat)
- Arbeitsspeicher: 32 KB I-RAM (1 cycle/32 bit) + 96 KB VRAM (1-2 cycles) + 256 KB eRAM (6 cycles/32 bit)
- Klang: Lautsprecher (mono) / Kopfhörer (stereo)
- Mehrspieler: Vier (zusammen mit GBAs oder GBA-SPs) bzw. zwei (mit Game Boy oder Game Boy Color)
- Stromversorgung: 2 × 1,5 Volt-AA-Batterien
- Batterielaufzeit: ca. 15 Stunden (variiert je nach Spiel)
- Abmessungen: 14,45 cm breit × 8,2 cm hoch × 2,45 cm tief
- Gewicht: ca. 140 g
- Steckmodul: 6,0 cm breit × 3,45 cm hoch × 0,95 cm tief; maximal 4 GBit (512 MByte), (maximal 256 Mbit (32 MByte) Speicher von Werk aus)
- Kompatibilität: spielt alle Game-Boy- und Game-Boy-Color-Spiele ab
Spielemodul
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Spiele wurden wie auch bei den Vorgängern weiterhin auf Modul ausgeliefert. Im Gegensatz zu den alten Game-Boy-Modulen waren diese nur noch gut halb so groß, besaßen aber weit mehr Speicher für die Spiele (GBC max. 32 Mbit/4 MB, GBA max. 512 Mbit/64 MB).
Im Gegensatz zu früheren Spielen wurde bei Game-Boy-Advance-Spielen ab 2002 statt auf batteriegepufferten Speicher auf Flashspeicher oder EEPROM-Speicher gesetzt, der alle Speicherstände sicher speichern konnte, auch ohne Stromversorgung. Lediglich einige Spiele wie z. B. die Pokémon-Reihe hatten weiterhin eine Batterie für die Echtzeituhr auf der Platine.
Spiele konnten dank der verbesserten Technik nun auch zu zweit mit nur einem Spiel gespielt werden, dazu war ein Game Boy Advance pro Spieler sowie für zwei Spieler ein Linkkabel, für drei Spieler zwei Linkkabel und für vier Spieler drei Linkkabel nötig.
Zubehör
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Als wichtigstes Zubehör erwies sich das Multiplayer-Linkkabel, welches später durch einen Wireless Adapter abgelöst werden sollte. Dieser Adapter wird aber nur von wenigen Spielen unterstützt (z. B. Mario Golf Advance Tour). Das neue Linkkabel hatte in der Mitte des Kabels selbst einen Hub eingebaut, der das Einstecken eines weiteren Linkkabels ermöglichte. So konnte man ohne weiteres Zubehör, bis auf die Kabel selbst, das Spiel mit bis zu vier Spielern spielen.
Ein ähnliches Kabel, welches veröffentlicht wurde, diente dazu, den Game Boy Advance mit Nintendos zu der Zeit aktueller Heimkonsole, dem Nintendo GameCube, zu verbinden. Anders als das Multiplayer-Linkkabel hatte es nur einen Stecker für den Game Boy Advance und einen für eine Controllerbuchse des GameCube. Auf angeschlossenen GBAs konnte so von bestimmten GameCube-Spielen erweiterte Informationen angezeigt oder der GBA selbst als Controller verwendet werden. Teilweise wurden Game-Boy-Advance-Spiele zeitgleich mit kompatiblen GameCube-Spielen veröffentlicht, das erste Spiel, das diese Möglichkeit nutzte, war Sonic Adventure 2 Battle in Verbindung mit Sonic Advance.
Game Boy Advance SP
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Mit dem Game Boy Advance SP (kurz: GBA SP; SP für „Special“[7]) veröffentlichte Nintendo Anfang 2003 die erste überarbeitete Version des Game Boy Advance im zuklappbaren Notebook-Design. Anders als bei den Nintendo-DS-Konsolen wird das Spiel allerdings nicht pausiert, wenn das Gerät zugeklappt wird. Die Technik zur Wiedergabe von Spielen entspricht der seines Vorgängers, lediglich das Design, der Bildschirm und die Stromversorgung wurden verändert. Der Bildschirm enthält nun eine Beleuchtungsfunktion, die durch einen Knopfdruck ein- und ausgeschaltet werden kann, und in das Gerät ist anstatt eines einfachen Batteriefachs ein auswechselbarer Lithium-Ionen-Akku integriert. Außerdem wird das Display auf Grund der Klappfunktion nun besser vor Kratzern geschützt. Doch das Design weist auch Mängel auf; so kritisieren Fans zum Beispiel, dass die älteren GBC- und GB-Spiele weit vorne aus dem Gerät herausragen, dass zum Anschluss eines Kopfhörers eigens ein separat zu erwerbender Adapter nötig ist und dass sich der Akku nur mit speziellen Ladegeräten laden lässt. Das Modell hat sich insgesamt mit ca. 42 Millionen verkauften Exemplaren öfter verkauft als das Ur-Modell mit über 35 Millionen verkauften Exemplare.
2005 erschien ein überarbeitetes SP-Modell (Modell AGS-101), welches das bisherige Frontlight (Beleuchtung des LCD von vorne) durch eine Hintergrundbeleuchtung ersetzte. Die GBA-Spiele haben auf diesem erweiterten SP in etwa die Optik, die sie beim Betrieb auf einem Nintendo DS oder Nintendo DS Lite erreichen. Das verbesserte Modell wurde Ende 2006 in Deutschland in den Farben „Surf Blue“, „Pearl Pink“ und „Tribal“ angeboten und ist neben der Farbe an einer neuen Verpackung zu erkennen. Allerdings gibt es auch alte Modelle (AGS-001) in den neuen Farben, somit lässt sich nur anhand der Modellnummer auf der Unterseite das Gerät richtig identifizieren. Die Bildschirmbeleuchtung lässt sich bei diesen Modellen in zwei Stufen anpassen, ist aber nicht mehr abschaltbar.
Technische Daten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Größe (zugeklappt): 84,6 mm breit × 82 mm hoch × 24,3 mm tief
- Gewicht: 146 g, mit Game-Boy-Advance-Spiel: 156 g, mit Game-Boy-Color-Spiel: 168 g
- Prozessor: 16,77 MHz 32 bit RISC-CPU (ARM7tdmi) (mit ROM) + 8 bit CISC-CPU-(Z80)
- Speicher: 32 KB IRAM (1 cycle/32 bit) + 96 KB VRAM (1-2 cycles) + 256 KB EWRAM (6 cycles/32 bit)
- Bildschirm: 61,2 mm breit × 40,8 mm hoch; 240 × 160 Pixel; AGS-001: Front-Light-Beleuchtung, AGS-101: Backlight-Beleuchtung
- Farben: max. 32.768 Farben gleichzeitig;
- Akku: Li-Ion-Akku; ohne Beleuchtung: 18 Stunden Laufzeit; mit Beleuchtung: 10 Stunden Laufzeit; 3 Stunden Aufladezeit, bei GBA SP (2006) immer 10-11 Stunden.
- Sonstiges: Linkport, abwärtskompatibel
Game Boy Micro
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Der Game Boy Micro (stilisierte Eigenschreibweise: GAME BOY mıcro, kurz: GB Micro oder GBM) ist eine sehr kleine Version des Game Boy Advance. Erstmals wurde er auf Nintendos Pressekonferenz zur E3 2005 der Öffentlichkeit vorgestellt. Er soll laut Nintendos Marketing-Sprecher Reginald Fils-Aime den „imagebewussten Käufer“ ansprechen.
Der Game Boy Micro bietet alle Funktionen des Game Boy Advance SP, kann allerdings keine Game-Boy- und Game-Boy-Color-Module abspielen. Zusätzlich bietet er im Gegensatz zu der ersten Generation der GBA-SP-Modelle eine farbechtere Hintergrundbeleuchtung, deren Helligkeit eingestellt werden kann sowie einen entspiegelten Flüssigkristallbildschirm.
In Japan erschien der Game Boy Micro am 13. September, eine Woche später auch in den USA. In Europa erschien der Handheld am 4. November 2005. Seine Veröffentlichung nach dem Erscheinen des Nintendo DS bekräftigte Nintendos Aussagen, dass die Geräte der Game-Boy-Advance-Familie parallel zum Nintendo DS laufen sollten. Der Game Boy Micro war jedoch angesichts dessen mit drei Millionen verkauften Exemplaren ein Flop. Als auch die Verkaufszahlen der anderen beiden Modelle zusehends schwächer wurden und Nintendo keinen Nachfolger herausbrachte, nahm die Game-Boy-Advance-Reihe daher mit dem Game Boy Micro ein Ende.
Im Gegensatz zu seinen Vorgängern bietet der Game Boy Micro ein Metallgehäuse. Die Frontabdeckung besteht aus Kunststoff und lässt sich durch eine der separat erhältlichen alternativen Abdeckungen austauschen.
Technische Daten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Größe: 10 cm breit × 5 cm hoch × 1,8 cm tief
- Gewicht: ca. 80 g
- Farben: silber, blau, rosa und grün (unterschiedliche Farben und Designs durch austauschbare Front-Abdeckung)
- Prozessor: 16,77 MHz 32 bit RISC-CPU
- Bildschirm: 2 Zoll (gegenüber 2,9" beim GBA), entspiegelt, einstellbare Hintergrundbeleuchtung in 5 Abstufungen, nicht abschaltbar
- Batterie: eingebauter Lithium-Ionen-Akku
- Kopfhörer: unterstützt Kopfhörer per Klinkenanschluss
- Software: alle Game-Boy-Advance-Spiele, nicht kompatibel mit Game-Boy- und Game-Boy-Color-Spielen
Literatur
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Alex Custodio: Who Are You?: Nintendo's Game Boy Advance Platform. In: Platform Studies. Band 11. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 2020, ISBN 978-0-262-04439-4 (englisch).
- Robert Bannert, Thomas Nickel, Martin Nagel: Das inoffizielle GBA-PIXELBUCH. edition elektrospieler, Mering 2023, ISBN 978-3-9821061-3-7.
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- PlanetGameboy.de Deutschlands größtes Onlinemagazin zum Game Boy Advance
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ a b Dedicated Video Game Sales Units. In: nintendo.co.jp. 31. Dezember 2020, abgerufen am 17. März 2021.
- ↑ Top 200 best-selling GBA games. In: VGChartz. Abgerufen am 6. September 2013 (englisch).
- ↑ Dedicated Video Game Sales Units. Nintendo, 30. September 2024, abgerufen am 11. Januar 2025 (englisch).
- ↑ Tobias Schmitz: Inside Nintendo 90: Die Geschichte hinter dem Game Boy Advance (Teil 1). In: Nintendo-Online. 17. April 2016, abgerufen am 30. März 2021.
- ↑ Umezu, Sugino, Konno. Interview von Satoru Iwata. Nintendo 3DS (Volume 2 – Nintendo 3DS Hardware Concept). In: Iwata Asks. (Interview-Transkript). Abgerufen am 10. Januar 2023. (englisch)
- ↑ TASVideos / Platform Framerates. Abgerufen am 7. März 2020.
- ↑ nintendo.com – What does "SP" stand for? (englisch) abgerufen am 27. November 2013
| Stationäre Spielkonsolen |
Color TV-Game (6 • 15 • Racing 112 • Block Breaker • Computer TV-Game) • Nintendo Entertainment System (Famicom) • Super Nintendo Entertainment System • Virtual Boy • Nintendo 64 (iQue Player) • Nintendo GameCube (Panasonic Q) • Wii (Wii mini) • Wii U • NES Classic Mini • Nintendo Switch • SNES Classic Mini • Nintendo Switch 2 |
|
| Tragbare Spielkonsolen |
Game & Watch • Game Boy • Game Boy Color • Game Boy Advance (SP • Micro) • Pokémon Mini • Nintendo DS (Lite • DSi) • Nintendo 3DS (2DS • New 3DS • New 2DS XL) • Nintendo Switch (Lite) • Nintendo Switch 2 | |
| Arcade-Automaten |
Nintendo Entertainment System (NES)
Das Nintendo Entertainment System (kurz meist NES genannt) ist eine stationäre 8-Bit-Spielkonsole des japanischen Spielkonsolenherstellers Nintendo. Die Konsole erschien in den 1980er-Jahren in Nordamerika, Brasilien, Europa, Asien und Australien. Die japanische Version wurde als Famicom (kurz für Family Computer) vermarktet. Das NES war mit über 60 Millionen verkauften Einheiten lange Zeit die meistverkaufte Konsole. Nach dem Zusammenbruch der Videospielebranche im Jahre 1983, dem sogenannten „Video Game Crash“, belebte Nintendo den Heimkonsolenmarkt mit ihrer Konsole neu. Der Controller führte das Steuerkreuz (kurz: D-Pad für Direction-Pad) ein und definierte die grundsätzliche Tastenanordnung der Gamepads. Bekannte Spieleserien wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Metroid oder Castlevania gaben auf dem NES ihr Heimkonsolen-Debüt.
Geschichte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nach einigen erfolgreichen Spielhallenautomaten in den frühen 1980er-Jahren plante Nintendo eine Videospielkonsole für den Heimgebrauch mit austauschbaren Spielmodulen. Masayuki Uemura entwarf schließlich das Famicom, das in Japan am 15. Juli 1983 veröffentlicht wurde und zu einem Preis von 14.800 Yen zu erstehen war. Bis Ende 1984 mauserte sich das Famicom zur bestverkauften Videospielkonsole in Japan. Zu dieser Zeit plante Nintendo bereits einen Verkaufsstart in den USA, wo der Videospielmarkt aufgrund des Branchenzusammenbruchs von 1983 praktisch nicht existent war. Zunächst gab es die Überlegung, die Konsole in den USA unter Ataris Namen zu veröffentlichen, doch deren Interesse richtete sich mehr auf den Heimcomputermarkt. Deswegen nahm Nintendo den Vertrieb selbst in die Hand.
Erstmals wurde die Konsole als Nintendo Advanced Video System vorgestellt, mit Zubehör wie einer Tastatur, Kassettenrekorder, Infrarotjoystick und einem speziellen BASIC Programming Language-Modul. Das kompliziert und überladen wirkende AVS wurde nochmals überarbeitet und in abgespeckter Version auf der CES (Consumer Electronics Show) im Juni 1985 als Nintendo Entertainment System vorgestellt. Nach einem erfolgreichen Start in New York mit ca. 50.000 verkauften Einheiten veröffentlichte man am 18. Oktober 1985 das NES schließlich landesweit; zunächst nur in ausgesuchten Verkaufsstellen, später gab es die Konsole überall zu kaufen. Die Konsole wurde in zwei verschiedenen Paketen angeboten: Das NES Deluxe Set beinhaltete neben der Konsole den R.O.B. (siehe unten), einen Zapper (siehe unten), zwei Controller und die Spiele Duck Hunt und Gyromite und war für 249 US-Dollar zu erstehen; das NES Action-Set mit einem Super-Mario-Bros.-/Duck-Hunt-Multimodul gab es für 199 USD. Für den Rest der Dekade war das NES die unangefochtene Nr. 1 des amerikanischen und japanischen Marktes, und die Spiele brachen einen Verkaufsrekord nach dem anderen.
Als ausschlaggebend für den Erfolg des NES in den USA gilt vor allem Nintendos Geschäftspolitik, die in vielfacher Hinsicht auch auf den Zusammenbruch der Spieleindustrie reagierte und eine Wiederholung der Fehler, die zu diesem Zusammenbruch geführt hatten, vermied: Entscheidend war vor allem, dass Nintendo durch Lizenzierung selber die weitgehende Kontrolle über die Veröffentlichung von Spielen für sein System behielt. Dies geschah einerseits mittels des hierfür eingeführten Nintendo Seal of Quality, das die Abnahme eines Spiels durch Nintendo selber attestierte, andererseits über die exklusive Produktion kompatibler NES-Spielmodule durch Nintendo und deren kontingentierte Zuteilung an Dritthersteller. Diese Geschäftspraktik wurde von den Entwicklern gelegentlich als restriktiv betrachtet und führte mehrfach auch zu juristischen Auseinandersetzungen, beispielsweise mit Tengen, brachte umgekehrt aber auch Vorteile, da die Spiele selber teils vom Nintendo-Marketing profitieren konnten. Zu letzterem gehörte auch die Einrichtung des Club Nintendo mit dem zugehörigen gleichnamigen Magazin als Werkzeug für Werbung und Kundenbindung.
In Europa und Australien – den Regionen mit PAL-Fernsehnorm – wurden die Märkte aufgeteilt in PAL A und PAL B. Mattel (PAL A) war für den Vertrieb des NES und dessen Spielen in Großbritannien, Australien und Italien zuständig; der PAL-B-Markt, welcher aus dem restlichen Europa bestand, wurde unter verschiedenen Distributoren aufgeteilt (beispielsweise die Firma Bienengräber in Deutschland, welche schon die Game-&-Watch-Spiele erfolgreich vertrieben hatte). Mit der Eröffnung von Nintendo of Europe übernahm Nintendo selbst den Vertrieb.
Als in den 1990ern die ersten 16-Bit-Konsolen (wie beispielsweise das Sega Mega Drive) Einzug hielten, ging die Dominanz des NES langsam zu Ende. Auch Nintendo veröffentlichte zu Beginn der 1990er Jahre die Nachfolgekonsole Super Nintendo Entertainment System, kurz SNES. Nintendo unterstützte das NES aber weiterhin und veröffentlichte noch eine neue, kleinere Version der Konsole in den USA, Japan und Australien. 1995 nahm Nintendo of America das NES nach stets sinkenden Verkaufszahlen schließlich offiziell aus dem Programm. In Europa erschienen die letzten Spiele 1996. In Japan wurde die Produktion des AV Famicom noch bis 2003 fortgesetzt.
Nach dem offiziellen Ende der Konsole im Westen entstand eine rege Sammlergemeinde rund um das 8-Bit-Gerät. Zusammen mit der wachsenden Emulation-Szene erlebte die Konsole in den späten 1990er Jahren sozusagen ihren zweiten Frühling. Auch heute erfreuen sich das NES und dessen Spiele nicht nur bei Videospielsammlern großer Beliebtheit. Nicht selten wird für begehrte Module und Zubehör weit mehr bezahlt, als sie bei ihrem Erscheinen gekostet haben.
Spiele
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Das erfolgreichste Spiel auf dem NES ist Super Mario Bros., welches im Westen zusammen mit der Konsole verkauft wurde. Mit über 40 Millionen verkauften Einheiten war es das mit Abstand meistverkaufte Videospiel, bis es 2008 vom 82,69 Millionen Mal verkauften Wii Sports übertroffen wurde.


Einige weitere bekannte Spiele auf dem NES:
.mw-parser-output .column-multiple,.mw-parser-output div[style*=column]{margin-top:0.3em}.mw-parser-output .column-multiple>ol,.mw-parser-output .column-multiple>ul,.mw-parser-output .column-multiple>p,.mw-parser-output div[style*=column]>ol,.mw-parser-output div[style*=column]>ul{margin-top:0}.mw-parser-output .column-multiple li,.mw-parser-output div[style*=column] li,.mw-parser-output .column-multiple-avoid{break-inside:avoid;break-inside:avoid-column;page-break-inside:avoid}.mw-parser-output .column-multiple-avoid-3{orphans:3;widows:3}.mw-parser-output .column-multiple .mw-heading{column-span:all}- Battletoads (1991)
- Blaster Master (1988)
- Bubble Bobble (1988)
- Bucky O' Hare (1992)
- Castlevania 1–3 (1986–1989)
- Contra und Super C (in Europa: Probotector, Probotector II) (1988 bzw. 1988)
- Crystalis (1990)
- Donkey Kong (1981)
- Donkey Kong Jr. (1982)
- Dr. Mario (1990)
- DuckTales (1989)
- Excitebike (1984)
- Final Fantasy 1–3 (1987 bzw. 1990)
- Gargoyles Quest 2 (1992)
- Gradius 1 und 2 (1985 bzw. 1988)
- Ice Climber (1985)
- Kid Icarus (1986)
- Kickle Cubicle (1990)
- Kirby's Adventure (1993)
- Mega Man 1–6 (1987–1993)
- Metal Gear (1987)
- Metroid (1986)
- Mother (1989)
- Ninja Gaiden 1–3 (1989–1991)
- Nintendo World Cup (1990)
- North & South (1989)
- Paperboy (1985)
- Prince of Persia (1990)
- Mike Tyson's Punch-Out!! (1987)
- Rad Racer 1 und 2 (1987 bzw. 1990)
- Snake Rattle ’n’ Roll (1990)
- Super Mario Bros. (1985)
- Super Mario Bros. 2 (1988)
- Super Mario Bros. 3 (1988)
- StarTropics 1 und 2 (1990 bzw. 1994)
- Tetris (1989)
- Teenage Mutant Ninja Turtles (1989)
- The Legend of Zelda und Zelda II: The Adventure of Link (1987)
Zubehör
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Famicom Disk System
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]In Japan erschien für das Famicom ein Diskettenlaufwerk, das über den Modulschacht an die Konsole angeschlossen wird. Zahlreiche bekannte Spiele wurden auf Diskette umgesetzt oder lieferten dort gar ihr Debüt ab.
Power Pad
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Das Power Pad ist eine Art Tanzmatte und unterstützt vor allem Sportspiele. Die verschiedenen auf der Matte befindlichen Knöpfe werden mit den Füßen betätigt, wodurch die Spielfigur am TV beispielsweise zu rennen beginnt oder zum Sprung ansetzt. In Europa erschienen mit Athletic World und Stadium Events lediglich zwei Spiele, die von der Fitnessmatte Gebrauch machen, in den USA war die Auswahl hingegen etwas größer. Als Konzept ist sie ein direkter Vorgänger des Wii Balance Boards, das erfolgreich für die Nintendo Wii vermarktet wurde (Wii Fit).
NES Advantage
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Der NES Advantage ist ein einem Spielhallenautomaten nachempfundenes Joyboard inklusive Knöpfen und Joystick. Vor allem für klassische Arcade-Spiele, wie beispielsweise Shoot ’em ups, soll sich das Eingabegerät bestens eignen. Neben dem Joystick bietet das Gerät auch regulierbare Autofeuer-Knöpfe und eine Zeitlupenfunktion, die allerdings nur einen wiederholten Aufruf des Start-Knopfes, der bei den meisten Arcade-Portierungen für das NES die Pause-Funktion aktiviert, darstellt, so als würde man immer wieder das Spiel für eine kurze Zeit unterbrechen, sodass der Spielvorgang langsamer voranschreitet. Der NES Advantage hat zwei Anschlusskabel, um es zwei Spielern abwechselnd zu ermöglichen damit zu spielen. Auf der Oberseite befindet sich der Schiebeschalter zum Wechseln des aktiven Spielers.
In der US-amerikanischen Science-Fiction-Komödie Ghostbusters II wird ein NES Advantage als Requisite zur Steuerung der Freiheitsstatue benutzt.[3]
NES Four Score
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Der NES Four Score ist ein Mehrspieleradapter und lässt bis zu vier Spieler gleichzeitig mit- oder gegeneinander spielen. Spiele, die den Four Score unterstützen, sind zum Beispiel Nintendo World Cup, Gauntlet 2 oder auch Super Spike's V'Ball. Neben den vier Controlleranschlüssen gibt es auch eine manuelle Autofeuerfunktion für den A- und B-Knopf.
NES Max
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Der offizielle NES-Max-Controller bietet, wie viele spätere Controller, links und rechts einen Griff, um das Halten des Steuerelements komfortabler zu gestalten. Das auffälligste Merkmal des Eingabegerätes ist jedoch der sogenannte Cycloid, eine Scheibe, welche das Standard-Steuerkreuz ersetzt und sich umherschieben lässt und auf Druck die Richtung angibt. Zusätzlich wurden noch Autofeuer-Knöpfe von A und B angebracht.
Power Glove
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Der Power Glove ist ein Datenhandschuh für den rechten Arm. Mittels am TV anzubringender Sensoren kann man durch Bewegungen des Armes das Spiel steuern. Für zahlreiche Titel war bereits eine Steuerung programmiert, für viele muss man diese jedoch noch selbst kalibrieren. Das Spiel Super Gloveball war speziell auf den Power Glove ausgerichtet, ansonsten hielt sich der praktische Nutzen sehr in Grenzen. In der Computerspielkultur gelangte er zu zweifelhafter Berühmtheit, die sich auf eines der frühesten Beispiele für einen „Hype-Backlash“ zurückführen lässt: Nintendo ließ den Powerglove (neben vielen anderen allzu offensichtlichen Produktplatzierungen) in dem Hollywood-Blockbuster Joy Stick Heroes (englisch The Wizard) vor dem eigentlichen Verkaufsstart bewerben. Die Dissonanz zwischen Werbeversprechen und Realität und die unfreiwillige Komik des Filmdialogs, die diese a posteriori reflektiert (Zitat: „I love the Powerglove. It's so bad!“; wobei bad gleichzeitig als „voll krass“ oder „grottenschlecht“ verstanden werden kann), hat dem Gerät vorläufig einen festen Platz im Humor der Nerd-Kultur gesichert.
Im Kurzfilm Kung Fury, dessen Handlung im Jahr 1985 angesiedelt ist, benutzt der Hacker „Hackerman“ den Power Glove, um eine Zeitreise durchzuführen.[4]
R.O.B.
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Der Robotic Operation Buddy, kurz R.O.B., der ursprünglich OTTO heißen sollte, gehörte in den USA beim Deluxe Set zur Grundausstattung.[5] Für den Betrieb werden vier AA-Batterien sowie eine D-Batterie für den Gyro-Motor benötigt.[5] Mittels Sensoren in den Augen kann der kleine Roboter Informationen und Befehle vom TV-Bildschirm empfangen, welche via Tastendruck ausgelöst werden. So hebt R.O.B. beispielsweise Klötzchen hoch und öffnet damit im Spiel gleichzeitig eine versperrte Tür. Er wurde auf der Summer Consumer Electronics Show 1985 in Chicago vorgestellt und ließ die Verkaufszahlen des NES in den USA in die Höhe steigen.[5] Insgesamt machten lediglich zwei Spiele von dem skurrilen Zubehör Gebrauch: Gyromite (im Lieferumfang des Deluxe Set enthalten) und Stack Up.[5] Obwohl R.O.B. nur sehr langsam arbeitete und vergleichsweise klobig zu bedienen war,[5] gilt er unter Retro-Spielern heute als ein seltenes Sammlerstück[5] und hat einen gewissen Kultstatus erlangt. Er ist in Mario Kart DS, Super Smash Bros. Brawl, Super Smash Bros. for Nintendo 3DS / for Wii U und Super Smash Bros. Ultimate als Figur spielbar.
Zapper
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Der Zapper ist eine Lightgun für das NES, die bereits beim Start mitausgeliefert wurde (je nach Set). Mit der in Grau oder Orange erhältlichen Lichtpistole wird auf den TV-Bildschirm gezielt und beispielsweise auf Tontauben geschossen. Die bekanntesten Spiele für dieses Eingabegerät sind Duck Hunt, Gumshoe und Wild Gunman; weitere Titel sind beispielsweise Barker Bill's Trick Shooting, Shooting Range oder Operation Wolf. Prinzipbedingt funktioniert diese Art der Lightguns nur mit klassischen Röhrenfernsehern. Für Nintendos neuere Heimkonsole Wii gibt es eine neuere Version des Zappers.
Family Computer Network System
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]In Japan erschien mit dem Family Computer Network System ein Modem, mit dem es möglich war, verschiedene Online-Dienste an der NES zu nutzen. Ein Server stellte Services wie Wetterberichte, Aktienkurse oder auch Cheats für die Nutzer bereit. Spiele, die über das Internet gespielt werden konnten, waren zwar geplant, wurden jedoch nie realisiert.[6]
Weiteres Zubehör
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Vor allem in Japan gab es noch etliches weiteres, teils skurriles Hardware-Zubehör. Dazu zählt ein Mikrofon für Karaoke-Spiele, ein Modem plus zugehöriger Tastatur, Plattenspieler, Kassettenlaufwerk, eine 3D-Brille mit dem Namen Famicom 3D System und sogar eine Strickmaschine. Zudem erschienen in der ganzen Welt verschiedenste Controller-Varianten und Import-Adapter, die das Abspielen von Spielen anderer Regionen auf der eigenen Konsole ermöglichen. Ferner gab es Cheating-Module wie Action Replay oder Game Genie, welche durch Eingabe von Codes beispielsweise unbegrenzte Leben im Spiel verschaffen können.
Technische Daten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- CPU: Ricoh 2A03 (ein 6502-Derivat) getaktet mit 1,77 MHz (PAL) / 1,79 MHz (NTSC)
- Grafikchip: PPU Ricoh-Chip (NTSC: RP2C02, PAL: RP2C07) getaktet auf 5,37 MHz bzw. 5,32 MHz[7]
- Soundchip: Die Geräuschfunktionen sind in die CPU integriert (5 Soundkanäle). Zwei Rechteck-Wellenformen mit variabler Pulsbreite, eine Dreieck-Wellenform, ein Rauschgenerator und ein digitaler 6-Bit-Delta-PCM-Soundkanal.
- Speicher:
- RAM: 2 kB (manche Spiele wie z. B. Super Mario Bros. 3 (8 KB) enthalten zusätzlichen RAM)
- Video-RAM: 2 kB
- Modulgröße: 192 Kibit (= 24 KiB) – 6 Mibit (= 768 KiB)
- Auflösung:
- Farben und Sprites:
- 16 aus 52 Farben gleichzeitig darstellbar (Sprites)
- 25 aus 52 Farben gleichzeitig darstellbar (Hintergründe, 16 Hauptfarben, 8 Schattierungen + Grundfarbe dunkelgrau / schwarz)
- Spritegröße 8×8 Pixel oder 8×16 Pixel
- 64 Sprites gleichzeitig darstellbar (max. 8 pro Bildschirmzeile)
- Abmessungen: 255 mm × 85 mm × 202 mm
- Gewicht: 1247,9 g
Redesign
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
In Nordamerika und Australien erschien gegen Ende der 8-Bit-Ära eine kompaktere neuere Version des NES. In Nordamerika wurde die Konsole 1993 zu einem Preis von 49,99 USD veröffentlicht. Von Nintendo selbst wurde das Gerät nach wie vor als Nintendo Entertainment System verkauft, unter den Käufern etablierten sich Top Loading NES und NES 2 als gängige Bezeichnungen.
Änderungen gegenüber dem Standard-NES
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Die Hardware ist fast identisch, es fehlen jedoch die Composite-Ausgänge.
- Neuer Schacht für die Module, sogenannter Toploader, da das Modul nicht mehr waagerecht hineingeschoben und dann nach unten gedrückt werden muss, sondern senkrecht von oben eingesteckt wird.
- Das Äußere wurde völlig überarbeitet und ähnelt sehr der amerikanischen Version des SNES
- Das Gamepad des redesignten NES ist ebenfalls dem des SNES sehr ähnlich und ist aufgrund des Designs als DogBone-(Hundeknochen-)Controller bekannt.
- Der Toploader ist universell benutzbar, d. h., er kann US-Spiele sowie europäische Spiele abspielen.
- Ein Kritikpunkt an dem Gerät sind vertikale Streifen, die während des Spielens auf dem Bildschirm zu sehen sind. Nintendo brachte als Reaktion eine verbesserte Version der Konsole (in Japan als Famicom „AV“) auf den Markt.
Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Am 14. Juli 2016 kündigte Nintendo mit dem Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System eine neue, kleinere Version des NES an, die mit 30 vorinstallierten Spielen ausgestattet und am 11. November 2016 erschienen ist. Sämtliche Spiele sind vorinstalliert, das Gerät bietet keine Datenschnittstelle zur Erweiterung.[8]
Folgende 30 Titel sind auf dem Gerät gespeichert:
- Balloon Fight
- Bubble Bobble
- Castlevania
- Castlevania II: Simon's Quest
- Donkey Kong
- Donkey Kong Jr.
- Double Dragon II: The Revenge
- Dr. Mario
- Excitebike
- Final Fantasy
- Galaga
- Ghosts ’n Goblins
- Gradius
- Ice Climber
- Kid Icarus
- Kirby's Adventure
- Mario Bros.
- Mega Man 2
- Metroid
- Ninja Gaiden
- Pac-Man
- Punch-Out!! Featuring Mr. Dream
- StarTropics
- Super C
- Super Mario Bros.
- Super Mario Bros. 2
- Super Mario Bros. 3
- Tecmo Bowl
- The Legend of Zelda
- Zelda II: The Adventure of Link
NES-kompatible Nachbauten („Famiclones“)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Das NES zählt zu den am meisten unlizenziert nachgebauten Spielkonsolen. Als Sammelbegriff für diese Konsolen hat sich das Wort „Famiclone“ durchgesetzt, welches aus „Famicom“ (der japanischen NES-Version) und „Clone“ (Nachbau, Klon) abgeleitet ist. Selbst im Jahre 2010, also 25 Jahre nach Erscheinen der Konsole in den USA und trotz dessen, dass wesentlich leistungsfähigere 3D-Spielkonsolen in ihrer vierten Generation verfügbar sind, werden NES-kompatible Spielkonsolen weiterhin hergestellt. Da einige NES-Patente in den USA bereits 2005 abgelaufen sind, können dort nun legal sogenannte „Famiclones“ vertrieben werden, insofern diese keine urheberrechtlich geschützten Spiele enthalten, da deren Urheberrechtsschutz noch immer andauert. Zu den offiziell als NES-kompatibel vertriebenen Konsolen zählen unter anderem „Generation NEX“, „Yobo FC“ und „Famicom Portable“.
Allerdings sind diese sogenannten Famiclones nicht ohne weiteres mit US- und PAL-NES-Spielen kompatibel, da die japanischen Famicom-Spiele weniger Anschlusspins und damit kürzere PCBs haben. Auch sind Famiclones fast nie mit offiziellem Zubehör kompatibel, da andere Anschlüsse für die Controller benutzt werden (meist 9Pin-DSub-Buchsen).
Nintendo Entertainment System – Nintendo Switch Online
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Im Zuge des kostenpflichtigen Online-Zugangs Nintendo Switch Online für die Nintendo Switch am 19. September 2018 veröffentlichte Nintendo das virtuelle Nintendo Entertainment System. Kunden des Online-Services können aus einer monatlich wachsenden Bibliothek an NES-Spielen auf der Nintendo Switch wählen. Passend dazu veröffentlicht Nintendo Controller im NES-Design, die kabellos mit der Switch-Konsole verbunden werden.
Siehe auch
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Dendy (Spielkonsole), in Russland populärer Famiclone
- PlayChoice-10 (Arcade-Automat auf NES-Basis)
- NES Sound Format
- NES Remix, Spielemix für Wii U und Nintendo 3DS
Literatur
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Rainer Babiel, Ulrich Krockenberger: NES Game Power. Sybex, Köln 1991, ISBN 3-88745-899-0.
- Pat Contri: Ultimate Nintendo: Guide to the NES Library (1985-1995). The Punk Effect, USA 2016, ISBN 978-0-9973283-0-1.
- Nick von Esmarch, Garitt Rocha: Playing With Power: Nintendo NES Classics. Prima Games, USA 2016, ISBN 978-0-7440-1767-0.
- Timothy L. Hearn: The Nintendo Entertainment System: A Comprehensive Look at the History, Technology, and Success of the NES. CreateSpace Independent Publishing Platform, USA 2015, ISBN 978-1-5177-7921-4.
- Jeremy Parish: Good Nintentions: A 30th Anniversary of Nintendo Entertainment System. CreateSpace Independent Publishing Platform, USA 2015, ISBN 978-1-5121-0974-0.
- Jeremy Parish: Good Nintentions 1985: The Definitive Unauthorized Guide to Nintendo's NES Launch. CreateSpace Independent Publishing Platform, USA 2016, ISBN 978-1-5370-8079-6.
- David Sheff: Game Over. How Nintendo Zapped an American Industry, Captured Your Dollars, and Enslaved Your Children. Random House, New York 1993, ISBN 0-679-40469-4.
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Technische Daten des NES. In: Nintendo.de
- 40 Jahre NES: Die Geburt von Mario und Zelda, 14. Juli 2023, Heise.de
- Offizielle deutschsprachige Website des Four Score
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Hardware and Software Sales Units. Nintendo, abgerufen am 14. August 2015.
- ↑ Dedicated Video Game Sales Units. Nintendo, 30. Juni 2022, abgerufen am 30. August 2022 (englisch).
- ↑ Nerdism Reviews! 26. April 2012, archiviert vom .mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a{background-position:center right!important;background-repeat:no-repeat!important}body.skin-minerva .mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a{background-image:url("https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/OOjs_UI_icon_external-link-ltr-progressive.svg")!important;background-size:10px!important;padding-right:13px!important}body.skin-timeless .mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a,body.skin-monobook .mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a{background-image:url("https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/MediaWiki_external_link_icon.svg")!important;padding-right:13px!important}body.skin-vector .mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a{background-image:url("https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Link-external-small-ltr-progressive.svg")!important;background-size:0.857em!important;padding-right:1em!important}Original (nicht mehr online verfügbar) am 26. April 2012; abgerufen am 23. Februar 2020.
- ↑ LaserUnicorns: KUNG FURY Official Movie [HD]. 28. Mai 2015, abgerufen am 27. Juni 2016.
- ↑ a b c d e f R.O.B. – Wie ein kleiner Roboter das NES rettete. 21. September 2019, abgerufen am 4. Juli 2020.
- ↑ GlitterBerri's Game Translations: Developing the Famicom Modem. 29. Juni 2012, abgerufen am 9. April 2017 (englisch).
- ↑ Rgame – NES specificaties. Abgerufen am 20. Juli 2012 (englisch).
- ↑ Nintendo.de: Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System, abgerufen am 22. Juli 2016
| Stationäre Spielkonsolen |
Color TV-Game (6 • 15 • Racing 112 • Block Breaker • Computer TV-Game) • Nintendo Entertainment System (Famicom) • Super Nintendo Entertainment System • Virtual Boy • Nintendo 64 (iQue Player) • Nintendo GameCube (Panasonic Q) • Wii (Wii mini) • Wii U • NES Classic Mini • Nintendo Switch • SNES Classic Mini • Nintendo Switch 2 |
|
| Tragbare Spielkonsolen |
Game & Watch • Game Boy • Game Boy Color • Game Boy Advance (SP • Micro) • Pokémon Mini • Nintendo DS (Lite • DSi) • Nintendo 3DS (2DS • New 3DS • New 2DS XL) • Nintendo Switch (Lite) • Nintendo Switch 2 | |
| Arcade-Automaten |
Nintendo Gamecube
Der Nintendo GameCube [.mw-parser-output .IPA a{text-decoration:none}'geɪm 'kjuːb] (englisch für Spielwürfel, jap. ニンテンドー ゲームキューブ, Hepburn: Nintendō Gēmukyūbu, offiziell abgekürzt als GCN in Europa und Nordamerika und NGC in Japan, meist einfach nur GameCube oder kurz GC genannt) ist eine stationäre Spielkonsole des japanischen Konsolenherstellers und Videospielentwicklers Nintendo und Nachfolger des Nintendo 64. Er stand in direkter Konkurrenz zu Segas Dreamcast, Sonys PlayStation 2 und Microsofts Xbox. Er verkaufte sich weltweit etwa 21,74 Millionen Mal,[5] bis der Verkauf im Jahre 2007 offiziell eingestellt wurde.[6] Nachfolger des Nintendo GameCube ist die im Jahr 2006 erschienene Wii, deren erste Ausführung abwärtskompatibel zu Nintendo-GameCube-Software, -Speicherkarten und -Controllern war.
Geschichte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nintendo veröffentlichte den GameCube mit der Modellbezeichnung DOL-001 am 3. Mai 2002 in Deutschland, der Preis lag bei der Markteinführung bei 249 €.[7] In den USA war die Konsole bereits seit dem 18. November 2001 erhältlich, in Australien seit dem 17. Mai 2002. Der Arbeitstitel war zunächst Dolphin, deshalb auch die Seriennummern, die mit „DOL“ beginnen. Kurzzeitiger Arbeitstitel danach war Starcube, dieser wurde jedoch wenig später verworfen. Im Mai 2004 erschien eine weitere Ausführung des GameCube mit der Modellbezeichnung DOL-101, welche neben ein paar weiteren Änderungen den Disc-Schacht schneller öffnen ließ und weniger Anschlüsse auf der Rückseite bot.
Ursprünglich von Nintendo mit dem Ziel entwickelt, das Unternehmen wieder an die Spitze der Konsolenhersteller zu führen, musste der GameCube schon zur Veröffentlichung herbe Rückschläge einstecken: Die Verkaufszahlen lagen deutlich unter denen der PlayStation 2, mit Microsoft hatte Nintendo außerdem einen neuen starken Konkurrenten, vor allem in den USA, Nintendos traditionell stärkstem Markt. Ein weiteres Problem war nach Bekanntwerden der Verkaufszahlen die schlechte Unterstützung durch andere Hersteller. Dies führte zu weiterem Nachlassen der Verkäufe – bis ins dritte Jahr lagen die Verkaufszahlen des Nintendo GameCube und der Xbox in etwa gleich; ab 2004 knickten die Verkaufszahlen des Nintendo GameCube allerdings innerhalb weniger Monate ein.
Unabhängige Entwickler spendierten der Konsole keine Exklusivtitel mehr und Nintendo selbst war damit beschäftigt, Spiele für die neue Handheldkonsole, den Nintendo DS, zu entwickeln, der Ende 2004 vorgestellt wurde. Die Folge war eine anhaltende Software-Flaute ab Mitte 2004 bis zum Erscheinen der Nachfolgekonsole Wii: Neue Spiele erschienen nur noch spärlich.
Nintendo verkaufte rund 21,74 Millionen Einheiten des GameCube – weit weniger als die Konkurrenzkonsolen von Sony und Microsoft. Damit gilt die Konsole laut Nintendo als Flop.[8]
Für den GameCube erschienen Ableger vieler bekannter Nintendo-exklusiver Spieleserien, wie zum Beispiel Donkey Kong, The Legend of Zelda und Super Mario. Zusätzlich entstanden auch einige neue Spielserien, wie z. B. Pikmin; daneben belebte Nintendo die Metroid-Serie mit Metroid Prime 1 und 2 wieder.
In Japan erschien 2002 das Arcade-System Triforce, welches hardwaretechnisch auf dem GameCube basiert.
Im November 2006 erschien in Japan als Nachfolger des GameCubes die Nintendo Wii, die in Europa seit dem 8. Dezember 2006 erhältlich war. Die erste Ausführung der Wii war noch kompatibel zu Spielen und Controllern für den GameCube. Es ist allerdings nicht möglich, diese mit der Wii-Fernbedienung zu steuern oder die Spieldaten auf dem internen Flashspeicher zu speichern. Daher werden auf jeden Fall ein GameCube-Controller und eine Memory Card benötigt. Dafür sind an der Seite der Wii hinter einer Abdeckung Anschlüsse für vier Controller und zwei Slots für Memory Cards des GameCubes vorhanden. In den beiden späteren Hardware-Revisionen der Wii (RVL-101 und Wii mini) wurden diese jedoch weggelassen.
Die Produktion der Konsole wurde im Jahr 2007 eingestellt.
Ausführung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der GameCube ist ähnlich wie ein Würfel geformt und setzte als erste Spielekonsole von Nintendo auf einen optischen Datenträger (DVD) als Speichermedium für die Spiele, nachdem die Vorgängerkonsole Nintendo 64 massiv dafür kritisiert wurde, die Spiele auf einem Steckmodul zu speichern, die wenig Speicherplatz besaßen und hohe Kosten verursachten. Diese DVD hat einen Durchmesser von 8 cm (entspricht dem der MiniDVD) und einer Kapazität von 1,46 GByte. Die Inkompatibilität zu Standard-DVD-Laufwerken wird durch von der DVD-Norm abweichende Fehlererkennungscodes und Verwendung einer konstanten Drehzahl des Datenträgers hervorgerufen; dies sollte das Anfertigen von Kopien mit handelsüblichen DVD-Brennern auf MiniDVDs erschweren.
Zum Abspeichern von Spielständen wird eine spezielle Speicherkarte namens Memory Card verwendet, die an der Frontseite in das Gerät eingesteckt wird. Anfangs hatte die originale Memory Card von Nintendo eine zu geringe Speicherkapazität, um den Stand einiger Spiele, wie z. B. Die Sims abzuspeichern, doch bot Nintendo später Karten mit mehr Speicherplatz an (hierbei entspricht jeder Speicherblock 64 Kbit):
- Memory Card mit 0059 Blöcken (04 Mbit / DOL-008)
- Memory Card mit 0251 Blöcken (16 Mbit / DOL-014)
- Memory Card mit 1019 Blöcken (64 Mbit / DOL-020)
Neben einem digitalen Steuerkreuz verfügt der Controller (Modellbezeichnung: DOL-003) über zwei Analogsticks, vier Aktionstasten und einen Startknopf, die der Spieler mit den Daumen bedient. An der Stirnseite besitzt der Controller zwei analoge L- und R-Knöpfe, die aber auch jeweils einen digitalen Druckpunkt haben, der beim vollen Durchdrücken der Tasten betätigt wird, und einen digitalen Z-Knopf, der mit dem rechten Zeigefinger ausgelöst wird. An einer Konsole lassen sich bis zu vier Eingabegeräte anschließen. Der Controller verfügt zusätzlich über eine Rumble-Funktion.
Die Konsole und Eingabegeräte waren in Europa und den USA in den Farben Purple (oft auch als Indigo bezeichnet), Schwarz und Silber erhältlich sowie, seit Erscheinen des Spieles Mario Smash Football, auch in Pearl-Weiß. Der violette GameCube stellte hierbei das markenbestimmende Basisprodukt dar (vgl. hierzu etwa die Veröffentlichung der ersten GBAs, die ebenfalls violett waren), gefolgt von der schwarzen Variante, die von Anfang lediglich als Alternativ-Design verfügbar war.
In Japan waren zusätzlich die Farben Rot, Starlight Gold, Symphonic Green und Spicy Orange erhältlich. Der silberne GameCube war in limitierter Auflage als Zelda-, Mario-Kart- und Resident-Evil-4-Edition auch in PAL-Regionen erhältlich.
Panasonic Q
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Panasonic Q (SL-GC10) war eine offiziell lizenzierte Version des GameCube und wurde von der Firma Panasonic hergestellt. Der Unterschied zum Standard-GameCube besteht darin, dass er neben Spielen auch Video-DVDs und Audio-CDs abspielen kann. Das System wurde ausschließlich in Japan vertrieben und kam im Dezember 2001 für 39.800 Yen auf den Markt.[9]
Nintendo hatte mit Panasonic einen Vertrag über die Lieferung der Laser-Einheiten für den GameCube abgeschlossen. In diesem Vertrag war auch festgelegt, dass Panasonic von Nintendo die Erlaubnis erhält, DVD-Spieler herzustellen, die GameCube-Spiele lesen können.

Ein weiteres Merkmal des Panasonic Q war seine hintergrundbeleuchtete Flüssigkristallanzeige und die bei DVD-Spielern übliche Schublade. Außerdem hatte der Panasonic Q einen optischen 5.1-Dolby-Digital- sowie einen separaten Subwoofer-Ausgang. Das Gehäuse wurde aus Metall gefertigt. Erweiterungen, die für den normalen GameCube hergestellt wurden, funktionierten auch mit dem Panasonic Q. Einzige Ausnahme war der Game Boy Player, der auf Grund der Füße am Panasonic Q nicht genutzt werden konnte. Es gab jedoch einen extra angefertigten „Panasonic Q Game Boy Player“[10] mit der Modellbezeichnung SH-GB10.
Die Panasonic-Variante verfügt außerdem über drei Cinch-Ausgänge für Composite-Video und Stereo-Ton, S-Video und den vom normalen GameCube bereits bekannten „Digital-AV-Out“-Anschluss.
Aufgrund des vergleichsweise hohen Preises und des schleppenden Verkaufs wurde die Produktion zwei Jahre später im Dezember 2003 eingestellt.[11]
Zubehör
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Alternative Controller
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Wavebird-Controller

Nintendo bot einen separat zu erwerbenden Wavebird-Controller (stilisiert als WAVEBIRD, Modellbezeichnung: DOL-004[12]) an und etablierte damit den Funkcontroller, der kabelloses und im Gegensatz zur bis dahin bekannteren Infrarottechnologie bequemeres Spielen ermöglichte, da sogar durch solide Wände funktionsfähige Spielsteuerung möglich war.
DK Bongos
Mit dem Spiel Donkey Konga wurde die DK Bongos (Modellbezeichnung: DOL-021) vorgestellt. Der Bongo-Controller wird wie jeder andere Controller angeschlossen und besitzt neben zwei Trommelflächen auch einen Startknopf sowie ein Mikrofon zur Wahrnehmung von Klatschgeräuschen. Die Bedienmöglichkeiten sind ausschließlich auf das Spiel Donkey Konga abgestimmt. Man kann das Spiel allerdings auch mit einem gewöhnlichen Controller steuern. Der Klatschsensor kann außerdem durch einfaches Pfeifen überlistet werden. Weitere Verwendung finden die Bongos im Spiel Donkey Kong: Jungle Beat und Donkey Konga 2.
Mikrofon

Bei den Spielen Mario Party 6, Mario Party 7 und Odama wurde ein Mikrofon mit der Modellbezeichnung DOL-022 mitgeliefert. Damit können Teile dieser Spiele per Spracheingabe gesteuert werden. Odama enthielt noch zusätzlich eine Halterung (DOL-025), die es gestattet, das Mikrofon am Controller zu befestigen. Das Mikrofon wird im B-Port der Speicherkarte angeschlossen.
Sonstige Controller
Speziell für das Horrorspiel Resident Evil 4 wurde von Capcom ein Controller entwickelt, dessen Aussehen einer Motorsäge nachempfunden ist.
Seit der Mario-Version von Dancing Stage wird die Tanzmatte (DOL-024) unterstützt.
Online-Gaming
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Auch der GameCube unterstützte, wie die Konkurrenzkonsolen, Online-Gaming. Nintendo begann mit dem Verkauf von entsprechender Zusatzhardware im Frühjahr 2003. Um eine Internetverbindung herzustellen, musste auf der Unterseite der Konsole ein separat erhältliches Modem mit der Modellbezeichnung DOL-012 oder ein Breitband-Adapter mit der Modellbezeichnung DOL-015 eingesetzt werden. Es erschienen jedoch insgesamt nur drei Spiele, die die Online-Funktion des GameCube unterstützten: Phantasy Star Online I & II, Phantasy Star Online III C.A.R.D sowie das ausschließlich in Japan erschienene Homeland. Die Server für die beiden Phantasy-Star-Online-Spiele wurden am 31. März 2007 abgeschaltet, nur einen Monat später, am 30. April 2007, erfuhr auch Homeland das gleiche Schicksal. Es ist jedoch möglich, die Phantasy-Star-Online-Teile über private Server weiter online zu spielen.
Die Online-Funktion des GameCube wurde allgemein als Misserfolg gewertet. Dies lag hauptsächlich an der mangelnden Verbreitung des Online-Zubehörs, die von Anfang an durch das zu geringe Angebot an geeigneter Software erschwert war. Zum Start des Online-Zubehörs war nur ein einziges onlinefähiges Spiel verfügbar, Phantasy Star Online Episode I & II, das bereits zwei Jahre zuvor auf der Dreamcast erschienen war.
Der Breitbandadapter unterstützt auch Netzwerkspiele, ein solcher LAN-Modus ist in Mario Kart: Double Dash!!, Need for Speed: Most Wanted, Kirby Air Ride und 1080° Avalanche verfügbar. Für diese Spiele, die zwar im LAN, aber nicht über Internet gespielt werden können, wurde unabhängig von Nintendo von Fans das Tunneling-Programm namens Warp Pipe entwickelt, das LAN-Spiele mit moderaten Qualitätseinbußen auch internettauglich machen kann. Auch die XLink-Software erlaubt es, GameCube-LAN-Spiele via Internet zu spielen.
Sonstiges Zubehör
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Im Gegensatz zu NTSC-Version des GameCube, der das Bild nur via S-Video darstellt, bietet die PAL-Version des GameCube auch ein RGB-Signal für eine klarere und schärfere Bilddarstellung. Hierzu ist jedoch ein RGB-Kabel notwendig. Das offizielle GameCube-RGB-Kabel mit der Modellbezeichnung DOL-013 verfügt im Gegensatz zu Drittherstellerprodukten nicht über gesonderte Anschlüsse für eine Musikanlage.
Die PAL-Version des GameCube unterstützte softwareseitig kein Vollbildverfahren. Für den Digital-AV-Out-Anschluss verkaufte Nintendo am US- und japanischen Markt ein Component-Kabel, ein europäischer Dritthersteller stellte hierfür ein daraus modifiziertes RGB-Kabel her. Zur Nutzung musste beim Starten des GameCubes der B-Knopf gedrückt gehalten werden. Der digitale AV-Ausgang war weltweit in späteren Revisionen des GameCube mit der Modellbezeichnung DOL-101 nicht mehr integriert.

Mit Hilfe eines speziellen Verbindungskabels („DOL-011“) kann ein Game Boy Advance an den GameCube angeschlossen und in bestimmten Spielen als Controller verwendet werden. Auf dem Bildschirm des GBA werden dann je nach Spiel weitere Informationen angezeigt, manchmal auch ganz neue Spielfunktionen oder Spielmodi. Der Game Boy Micro lässt sich mit dem Verbindungskabel nicht verwenden.

Der Game Boy Player (DOL-017) ist ein Erweiterungsperipheriegerät für den GameCube und erlaubt das Spielen sämtlicher Game-Boy-Spiele über den GameCube am Fernseher. Dazu wird der Game Boy Player von unten an die Konsole gesteckt und das Game-Boy-Spiel in den Game Boy Player eingelegt. Zur Steuerung können alle verfügbaren GamePads genutzt werden, darunter auch die Game-Boy-Advance-Handhelds mithilfe des Verbindungskabels.[13]
Homebrew und Urheberrechtsverstöße
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Mit Erscheinen des Online-Titels Phantasy Star Online (am 7. März 2003 in Europa erschienen) wurde es erstmals für Privatpersonen möglich, unlizenzierte Software auf dem GameCube auszuführen. Das Spiel konnte im Online-Modus vom zentralen Spieleserver Programmteile nachladen. Eine Software für den PC konnte nun diesen Spieleserver simulieren und ein eigenes Programm zum GameCube schicken, welches dann ausgeführt wurde. Eine kryptografische Signatur wurde dort nicht verwendet, lediglich eine Verschlüsselung, die umgangen werden konnte, worauf später dieser Weg auch zum Spielen von urheberrechtswidrig hergestellter Kopien durch Streamen und Patchen der Daten über den Netzwerkadapter genutzt wurde.
Einen ersten Modchip, der dies direkt ermöglichte, gab es beim GameCube erst Ende 2004. Zuletzt wurde das Ausführen von Homebrew über ein Gerät mit der Bezeichnung SD Media Launcher (Datel Electronics) auf dem GameCube möglich. Die Software wird dabei durch eine Start-CD von einer SD-Speicherkarte geladen, die sich in einem Adapter im Schacht für die GameCube-Speicherkarten befindet.
Mittlerweile ist es auch möglich, durch Savegame-Exploits in diversen Spielen u. a. The Legend of Zelda: The Wind Waker und The Legend of Zelda: Twilight Princess unautorisierten Code auf dem GameCube auszuführen. Da dazu jedoch eine vorherige Manipulation der Memory Card vonnöten ist, was erst durch Homebrew auf der Wii einem großen Teil der Nutzer möglich wurde, hatten jene Savegame-Exploits zu Zeiten des Gamecubes keine Relevanz. Der Pufferüberlauf, der das Ausführen unautorisierten Codes durch The Legend of Zelda: Twilight Princess ermöglicht, ist auch in der Wii-Version enthalten und ermöglichte 2007 erstmals das Ausführen unautorisierten Codes auf der Wii und erlangte als sogenanntes Twilight Hack weitreichende Bekanntheit.
Emulation
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Mit der Software Dolphin existiert ein Emulator, der den Nintendo GameCube und die Wii auf einem Computer oder Smartphone emulieren kann.
Spiele (Auswahl)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Für den GameCube sind über 600 Spiele verfügbar, zu den bekanntesten zählen u. a.:
.mw-parser-output .column-multiple,.mw-parser-output div[style*=column]{margin-top:0.3em}.mw-parser-output .column-multiple>ol,.mw-parser-output .column-multiple>ul,.mw-parser-output .column-multiple>p,.mw-parser-output div[style*=column]>ol,.mw-parser-output div[style*=column]>ul{margin-top:0}.mw-parser-output .column-multiple li,.mw-parser-output div[style*=column] li,.mw-parser-output .column-multiple-avoid{break-inside:avoid;break-inside:avoid-column;page-break-inside:avoid}.mw-parser-output .column-multiple-avoid-3{orphans:3;widows:3}.mw-parser-output .column-multiple .mw-heading{column-span:all}- 1080° Avalanche
- Ab durch die Hecke
- Animal Crossing
- Baten Kaitos
- Donkey Konga 1–3
- Donkey Kong Jungle Beat
- Eternal Darkness: Sanity’s Requiem
- F1 2002
- F-Zero GX
- Final Fantasy Crystal Chronicles
- Fire Emblem: Path of Radiance
- killer7
- Kirby Air Ride
- The Legend of Spyro: A New Beginning
- Luigi’s Mansion
- Mario Golf: Toadstool Tour
- Mario Kart: Double Dash!!
- Mario Party 4–7
- Mario Power Tennis
- Mario Smash Football
- Magical Mirror Mickey Mouse
- Metroid Prime 1 & 2 Echoes
- Paper Mario: Die Legende vom Äonentor
- Phantasy Star Online 1–3
- Pikmin 1 & 2
- Pokémon Colosseum
- Pokémon XD: Der Dunkle Sturm
- Rayman 3: Hoodlum Havoc
- Resident Evil 4
- Sonic Adventure 2: Battle
- Star Fox Adventures
- Star Wars: Rogue Squadron II – Rogue Leader & Star Wars: Rogue Squadron III – Rebel Strike
- Super Mario Sunshine
- Super Monkey Ball 1 & 2
- Super Smash Bros. Melee
- Tales of Symphonia
- The Legend of Zelda: Four Swords Adventures
- The Legend of Zelda: The Wind Waker
- The Legend of Zelda: Twilight Princess
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time
- TimeSplitters 2
- True Crime: Streets of LA
- True Crime: New York City
- Tony Hawk’s: Pro Skater 3 & 4, Underground 1 & 2 sowie American Wasteland
- Wario World
- Wave Race: Blue Storm
- WWE Day of Reckoning 1 & 2
Technische Daten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]CPU
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Name: Gekko
- Art: 32-Bit-RISC-Prozessor
- Leistung: 485 MHz
- CPU: 1,9 GigaFLOPS / 925 MIPS / 1125 DMPIS
- Gesamtsystem: 13 GigaFLOPS (Spitze) (MPU, Geometry Engine, HW Lighting Total)
- Hersteller: IBM
- Kern: PowerPC 750CXe (G3) ähnlich
- Herstellungsverfahren: 0,18 µm (IBM Copper-Wire-Technologie)
- Taktfrequenz: 485 MHz, 162 MHz Front Side Bus
- Interne Datenformate:
- 32-Bit Integer
- 64-Bit Floating-point
- 2× 32-Bit-Floating-point-SIMD (paired single)
- Externer Bus:
- In der Spitze 1,3 GB/s Bandbreite
- 32-Bit-Adressspeicher
- 64-Bit-Datenbus; 162-MHz-Takt
- Interner Speicher:
- L1: Befehl 32 KB, Daten 32 KB (8 Wege)
- L2: 256 KB (2 Wege)
Grafik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Name: Flipper
- Hersteller: ArtX/Nintendo (ArtX ist seit 2000 Teil von ATI und gehört damit jetzt zu AMD)
- Herstellungsverfahren: 0,18 µm
- Taktfrequenz: 162 MHz
- Leistung: 9,4 GigaFLOPS
- Texturen pro Renderpass: 8
- Videomodi:
- 720 × 480 interlaced (480i) bei 60 Hz
- 720 × 576 interlaced (576i) bei 50 Hz (nur PAL)
- 720 × 480 progressive scan (480p) bei 60 Hz (nur NTSC)
- Polygon Performance: 40 (Peak) Millionen Polygone/Sekunde mit allen Effekten
- Eingearbeiteter Framebuffer und Z-Buffer:
- Etwa 2 MB Kapazität (jeweils 1 MB für die Buffer)
- Verträgliche Latenzzeit: 5 Nanosekunden
- RAM: 1T-SRAM
- Eingearbeiteter Texturencache:
- Etwa 1 MB Kapazität
- Verträgliche Latenzzeit: 5 Nanosekunden
- RAM: 1T-SRAM
- Texturlesebandbreite: In der Spitze 10,4 GB/s
- Hauptspeicherbandbreite: In der Spitze 2,6 GB/s
- Farbtiefe
- 24-Bit-RGB/RGBA
- 24-Bit-Z-Buffer
- Bildverarbeitungsfunktionen:
- Nebel
- Subpixel-Antialiasing
- 8 Hardwarelichter
- Alpha Blending
- Virtuelles Texturendesign
- Multi-texturing, Bumpmapping
- Environment Mapping
- Mip Mapping
- Bilineares Filtern
- Trilineares Filtern
- Anisotropes Filtern
- Echtzeit Hardwaretexturdekompression (S3TC)
- Echtzeit-Displaylist-Dekompression
- Dreizeiliger Hardware-Antiflackerfilter
- Analog-AV-Ausgang:
- Digital-AV-Ausgang:
- Komponentensignal (YPbPr) am proprietären Digital-AV-Port[15] (Wurde an allen GameCubes, die nach dem Mai 2004 produziert wurden, entfernt.[16])
Audio
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Hersteller: Macronix
- Proprietärer 16-Bit-DSP
- Taktfrequenz: 81 MHz
- Befehlsspeicher:
- Datenspeicher:
- 8 KB RAM
- 4 KB ROM
- Gleichzeitige Audiokanäle: 64 3D-Kanäle (Maximal Dolby Surround)
- Kodierung: ADPCM
- Samplingfrequenz: 48 kHz
- Dolby Surround ProLogic II
Zusätzliches
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- System-RAM:
- ARAM (Audio/Auxiliary RAM):
- 16 MB Kapazität
- SDRAM
- 81 MHz Taktrate, 8-Bit-Bus
- Laufwerk:
- Typ: Constant Angular Velocity (CAV)
- Zugriffszeit: 126 Millisekunden
- Datentransfer: max. 2,4 MB/s
- Datenträger:
- Hersteller: Panasonic
- Basiert auf DVD, aber proprietäres Format
- Durchmesser: 8 cm
- 1,46 GB Kapazität
- Controller-Anschlüsse: 4
- Memory-Card-Steckplätze: 2
- Analoge Audio/Video-Ausgänge: 1
- Digitale Audio/Video-Ausgänge: 1 (in der neueren Version des GameCubes nicht mehr vorhanden)
- Serielle Hochgeschwindigkeitsanschlüsse: 2 (für Modem oder Ethernet, für den zweiten Anschluss gibt es keine Geräte und er ist in der neueren Version des GameCubes ebenfalls nicht mehr vorhanden)
- Parallele Hochgeschwindigkeitsanschlüsse: 1 (für Game Boy Player)
- Stromversorgung: AC-Adapter DC 12 V, 3,25 A
- Abmessungen Konsole: 150 mm × 161,5 mm × 110 mm
- 4 Controller-Anschlüsse Game-Controller
Komponentensignal
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nintendo veröffentlichte im Mai 2004 eine Hardware-Revision des Gamecubes (DOL-101). Hierbei wurde weltweit der digitale AV-Out-Anschluss vollständig entfernt, der analoge AV-Out blieb jedoch bestehen. In Nordamerika und Japan veröffentlichte Nintendo ein Komponentenkabel, welches eine Auflösung von 480p ermöglichte und den digitalen AV-Out-Anschluss verwendete. Das originale Kabel von Nintendo verfügte über keine Audioausgabe, diese erfolgte weiterhin durch den analogen AV-Out-Anschluss. In Europa erschien dieses Kabel allerdings nie.
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Nintendo GameCube (offizielle Website von Nintendo)
- Liste aller im deutschsprachigen Raum erschienenen GameCube-Titel
- Linux für den GameCube
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Console GPU Power Compared: Ranking Systems By FLOPS (engl.) vom 3. November 2017, abgerufen am 29. Januar 2024
- ↑ Hardware and Software Sales Units. Nintendo, abgerufen am 14. August 2015.
- ↑ Gamecube-Spiele: Top 10 Bestseller - Von Metroid über Mario bis Super Smash Bros. GIGA, 3. Februar 2015, abgerufen am 18. August 2020.
- ↑ Dedicated Video Game Sales Units. Nintendo, 30. Juni 2022, abgerufen am 30. August 2022 (englisch).
- ↑ Consolidated Sales Transition by Region. (PDF) Archiviert vom .mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a{background-position:center right!important;background-repeat:no-repeat!important}body.skin-minerva .mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a{background-image:url("https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/OOjs_UI_icon_external-link-ltr-progressive.svg")!important;background-size:10px!important;padding-right:13px!important}body.skin-timeless .mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a,body.skin-monobook .mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a{background-image:url("https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/MediaWiki_external_link_icon.svg")!important;padding-right:13px!important}body.skin-vector .mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a{background-image:url("https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Link-external-small-ltr-progressive.svg")!important;background-size:0.857em!important;padding-right:1em!important}Original am 12. März 2012; abgerufen am 20. Juni 2018 (englisch).
- ↑ Nintendo stops Cube production vom 22. Februar 2007 (aufgerufen am 28. Februar 2014)
- ↑ GameCube: Nintendo nennt Preis und Einführungstermin. Abgerufen am 3. April 2025.
- ↑ .mw-parser-output .webarchiv-memento a{color:inherit}gamesindustry.biz (Memento vom 25. November 2013 im Internet Archive): Nur 25 Mio. Konsolen: Vernichtende Prognose für Wii U vom 21. November 2013 (aufgerufen am 24. November 2013)
- ↑ Christian Klaß: "Q" kommt - Matsushitas GameCube spielt auch DVD-Spielfilme Variante von Nintendos neuer Konsole ab Mitte Dezember in Japan erhältlich. In: golem.de. 22. Oktober 2001, abgerufen am 30. Mai 2017.
- ↑ GameCube Hardware (DOL) (Memento vom 15. April 2009 im Internet Archive)
- ↑ Thorsten Wiesner: Panasonics Kreuzung aus GameCube und DVD-Player eingestellt - Gerät wurde nie außerhalb Japans verkauft. In: golem.de. 18. Dezember 2003, abgerufen am 30. Mai 2017.
- ↑ DOL: Nintendo Game Cube. In: maru-chang.com. Abgerufen am 18. Juni 2019 (englisch).
- ↑ Nintendo Kundenservice - Game Boy Player. In: Nintendo.de. Abgerufen am 2. Juni 2013.
- ↑ http://www.gamesx.com/wiki/doku.php?id=av:nintendomultiav
- ↑ http://www.gamesx.com/wiki/doku.php?id=av:nintendodigitalav
- ↑ Nintendo GameCube Component Video Questions. Abgerufen am 27. April 2008 (englisch).
| Stationäre Spielkonsolen |
Color TV-Game (6 • 15 • Racing 112 • Block Breaker • Computer TV-Game) • Nintendo Entertainment System (Famicom) • Super Nintendo Entertainment System • Virtual Boy • Nintendo 64 (iQue Player) • Nintendo GameCube (Panasonic Q) • Wii (Wii mini) • Wii U • NES Classic Mini • Nintendo Switch • SNES Classic Mini • Nintendo Switch 2 |
|
| Tragbare Spielkonsolen |
Game & Watch • Game Boy • Game Boy Color • Game Boy Advance (SP • Micro) • Pokémon Mini • Nintendo DS (Lite • DSi) • Nintendo 3DS (2DS • New 3DS • New 2DS XL) • Nintendo Switch (Lite) • Nintendo Switch 2 | |
| Arcade-Automaten |
Nintendo Virtual Boy
Der Virtual Boy (jap. バーチャルボーイ, Bācharu Bōi) ist ein stationäres Virtual-Reality-Headset von Nintendo, das 1995 in Japan und den USA veröffentlicht wurde. Entwickelt wurde das Projekt unter der Bezeichnung VR32.[1][2]
Die Konsole ist ein Virtual-Reality-Headset, wird jedoch nicht wie die meisten VR-Headsets am Kopf befestigt und auch nicht während der Benutzung bewegt. Stattdessen hat der Virtual Boy einen Ständer, um ihn während des Spielens auf einen Tisch zu stellen. Der Spieler steuert mit einem mitgelieferten Gamecontroller. Jedes der beiden Displays besteht aus roten LEDs auf schwarzem Grund, wodurch das Bild monochrom ist. Auf ein farbiges Bild verzichtete Nintendo, da die damals erhältlichen grünen und blauen LEDs nicht effizient waren und die LCD-Technik aufgrund ihrer Bewegungsunschärfe nicht für die nötige Bildrate von etwa 50 Hz geeignet war. In jedem der beiden Displays befinden sich 224 rote LEDs, die in einer Reihe angeordnet sind. Mittels eines Spiegels, der von einer Mechanik in einer hohen Frequenz hin- und hergeschwungen wird, wird das Bild mit einer Auflösung von 384 × 224 Pixeln erzeugt. Durch den Spiegel war das Gerät kleiner und kostengünstiger als mit einer vollen LED-Bestückung, allerdings auch gegen Stöße empfindlicher.
Nintendo hat angekündigt, im Februar 2026 eine Auswahl von Virtual-Boy-Spielen in den Nintendo-Switch-Online-Service aufzunehmen. Zur Wiedergabe soll ein Zubehör namens Virtual Boy für Nintendo Switch benötigt werden.[3]
Technische Details
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Gewicht | 760 g |
| Größe | 21,7 × 25,4 × 11 cm |
| Stromversorgung | 6× 1,5-V-Batterien |
| Spielzeit (mit 6 Batterien) | 7 Stunden |
| CPU | 32-Bit NEC V810 RISC |
| CPU-Takt | 20 MHz (18 MIPS) |
| Max. Auflösung | 384 × 224 (pro Auge) |
| RAM | 1 MB D-RAM |
| Video RAM | 512 KB P-SRAM |
| Cache Memory | 1 KB |
| Sound | 16-Bit Stereo |
| Controller | 6 Knöpfe und 2 Steuerkreuze mit 2 Griffen |
| Bildfrequenz | 50 Hz |
Veröffentlichte Spiele
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- 3D Tetris (USA)
- Galactic Pinball (Japan, USA)
- Golf (Japan, USA)
- Innsmouth no Yakata (Japan)
- Jack Bros. (Japan, USA)
- Mario Clash (Japan, USA)
- Mario’s Tennis (Japan, USA)
- Nester’s Funky Bowling (USA)
- Panic Bomber (Japan, USA)
- Red Alarm (Japan, USA)
- SD Gundam Dimension War (Japan)
- Space Invaders Virtual Collection (Japan)
- Space Squash (Japan)
- Teleroboxer (Japan, USA)
- V-Tetris (Japan)
- Vertical Force (Japan, USA)
- Virtual Bowling (Japan)
- Virtual Boy Wario Land (Japan, USA)
- Virtual Fishing (Japan)
- Virtual Lab (Japan)
- Virtual League Baseball (Japan, USA)
- Waterworld (Japan)
Rezeption
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der Virtual Boy war in Japan ein Misserfolg. Statt kalkulierter 250.000 verkaufter Geräte lag der Absatz bei 140.000 Stück. Auch die Veröffentlichung in den USA, in die Nintendo weitere Hoffnungen gesetzt hatte, war ein Misserfolg. Kritiker nannten verschiedene mögliche Ursachen für das Scheitern des Geräts:
- Längeres Spielen konnte Kopfschmerzen verursachen. Der diesbezügliche Warnhinweis auf der Verpackung könnte Käufer abgeschreckt haben.[4]
- Zusätzlich gab es zahlreiche Diskussionen von Eltern, die eine Beeinträchtigung der Sehstärke ihrer Kinder durch den Virtual Boy befürchteten.[4]
- Viele hatten ein tragbares System erwartet und sahen ihre Erwartungen an das Gerät nicht erfüllt. Im Vergleich zu üblichen Heimkonsolen empfanden viele die Haltung beim Spielen als unbequem.[4]
- Die Auswahl an Software-Titeln war gering, und nur einige davon machten sinnvollen Gebrauch von den 3D-Fähigkeiten des Geräts. Spielehersteller zögerten mit der Entwicklung neuer Spiele, da das neuartige Konzept der Konsole unerprobt war.[4]
- Aufgrund des ungünstigen Erscheinungszeitpunkts konkurrierte der Virtual Boy mit dem Atari Jaguar, der Sega Saturn, der PlayStation und auch dem groß angekündigten Nintendo 64, dessen Start kurz bevorstand.[5]
- Vor der Veröffentlichung wurde ein Zweispielermodus angekündigt, also eine Möglichkeit, zwei Virtual Boys miteinander zu verbinden. Dieser wurde jedoch nie implementiert.[4]
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Planet Virtual Boy – größte Virtual Boy Website im Netz (auch auf Deutsch)
- neXGam.de – Testberichte & Specials zum Virtual Boy
- .mw-parser-output .webarchiv-memento a{color:inherit}Virtual Boy (Memento vom 23. Februar 2007 im Internet Archive) – Bereich auf der offiziellen Website von Nintendo of America
- Virtual Boy – Bereich auf der offiziellen Seite von Nintendo Co. Ltd. (Japan)
- AVGN (Angry Video Game Nerd) Virtual Boy Review – Review aller für den VB erschienener Spiele und des VB selbst.
- The Unofficial Nintendo Virtual Boy Home Page - Dedicated to hacking the VB. Heimat des Reality-Boy-VB-Emulators.
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Retro Review: Virtual Boy und die Vorfreude auf die virtuelle Realitä showmetech.com.br
- ↑ Frank Steinicke: Being Really Virtual, Seite 30, Springer, 2016
- ↑ https://www.nintendo.com/de-de/Spiele/Nintendo-Switch-Download-Software/Virtual-Boy-Nintendo-Classics-2915432.html
- ↑ a b c d e Graham Flanagan: The incredible story of the 'Virtual Boy' — Nintendo's VR headset from 1995 that failed spectacularly. In: Business Insider. 26. März 2018, abgerufen am 4. April 2019 (englisch).
- ↑ Marriott Guy, Ferry Groenendijk: Nintendo Virtual Boy. In: Video Game Console Library. Abgerufen am 4. April 2019 (englisch).
| Stationäre Spielkonsolen |
Color TV-Game (6 • 15 • Racing 112 • Block Breaker • Computer TV-Game) • Nintendo Entertainment System (Famicom) • Super Nintendo Entertainment System • Virtual Boy • Nintendo 64 (iQue Player) • Nintendo GameCube (Panasonic Q) • Wii (Wii mini) • Wii U • NES Classic Mini • Nintendo Switch • SNES Classic Mini • Nintendo Switch 2 |
|
| Tragbare Spielkonsolen |
Game & Watch • Game Boy • Game Boy Color • Game Boy Advance (SP • Micro) • Pokémon Mini • Nintendo DS (Lite • DSi) • Nintendo 3DS (2DS • New 3DS • New 2DS XL) • Nintendo Switch (Lite) • Nintendo Switch 2 | |
| Arcade-Automaten |